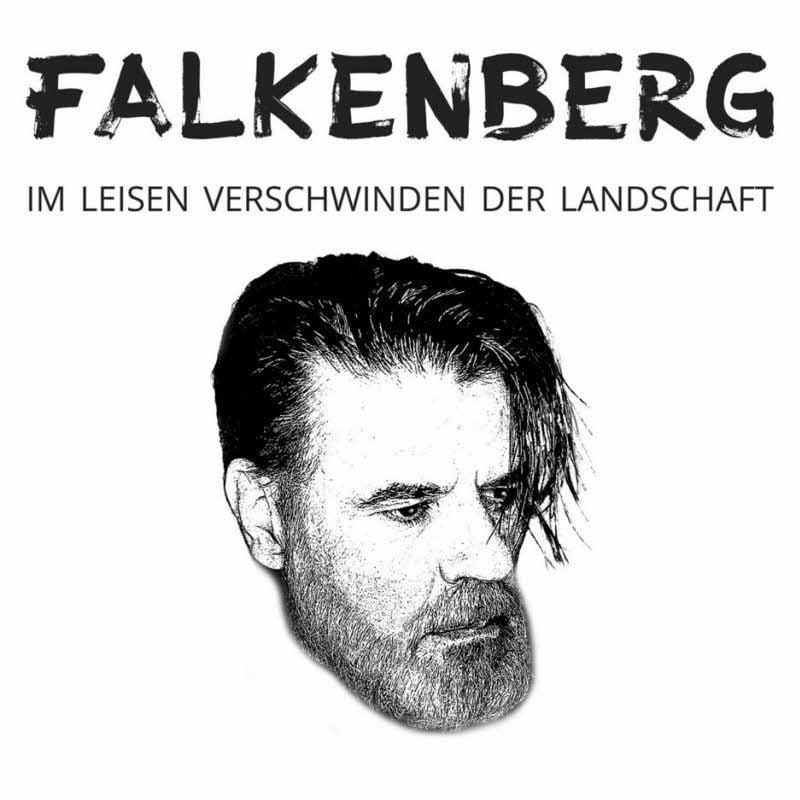Hymnen für harte Zeiten Rockpoet Falkenberg aus Halle hat 20. Album veröffentlicht - Hymnen für harte Zeiten

Halle (Saale) - Es ist ein Orkan, der da heranfegt. Vier Minuten stürmt die Musik vorbei wie eine Walze aus Bass, Gitarre und Schlagzeug. „Himmel in Scheiben“ hat der Musiker Falkenberg das Stück genannt, das wortlos vorübertost wie ein Sturmwind. Es ist wie ein Signal: Ralf Schmidt, wie Falkenberg bürgerlich heißt, liefert harte Klänge zu harten Zeiten, selbst wenn der Titel des neuen, inzwischen 20. Albums des gebürtigen Hallensers anderes vermuten lässt.
„Im leisen Verschwinden der Landschaft“ hat Schmidt die Sammlung von zwölf Liedern genannt. Sie tragen Titel wie „Welt ohne Vision“ und haben Texte, in denen „die Bäuche der ausgeraubten Meere“ gefüllt sind „mit dem Gift unserer ziellosen Gier“. Der 58-Jährige nennt das eine „Weiterführung dessen, was mich seit 20 Jahren beschäftigt“.
Punk und Popstar Falkenberg
So lange zurück rechnet Schmidt die aktuelle Phase seines Schaffens, die nach dem Zusammenbruch der DDR und Jahren als Fotograf in aller Welt begann. Vorher hatte der Junge, den die Kumpels „Schmatt“ nannten, sein Handwerk im Stadtsingechor gelernt, bei einer Punkband und bei Stern Meißen gesungen und war schließlich als IC Falkenberg zu einem der erfolgreichsten DDR-Popstars geworden. Zeiten ändern sich, Menschen, Lieder auch. „Es gibt neue Betrachtungswinkel“, sagt er, „aber der Grundwiderspruch bleibt der zwischen Glück und Gier.“
Die hat auf dem neuen Werk des Pianisten, Gitarristen und Sängers viele Facetten. „Wir zerstören nicht nur den Planeten, wir zerstören auch uns selbst“, sagt der Einzelkämpfer, der seine Alben selbst produziert und vertreibt. Der Konsumgesellschaft, die den Planeten verzehrt und Menschen glauben lässt, sie müssten mit Statussymbolen ihren Wert ausstellen, hält Falkenberg zu treibendem Rock den Spiegel vor: „Willkommen in der Zeit der Planetenzerstörer“, heißt es in „Die Kontinente“.
Der Mann hinterm Vollbart mag nicht mehr mittun. Einst Kettenraucher, kaffeesüchtig und keinem Backstagebier abgeneigt, hat er zuletzt alle Weichen neu gestellt. Tee statt Kaffee, frische Luft statt Kippen, kein Fleisch, kein Alkohol. Er habe erst manches weggelassen und dann alles, wovon er zuvor geglaubt habe, nicht darauf verzichten zu können, sagt er. „Und ich bin nicht nur ein gesünderer, sondern auch ein zufriedenerer Mensch.“
Der umso mehr an dem leidet, was sich draußen abspielt, in einer Welt, in der „wieder Leute mit faschistischem Denken in Parlamenten sitzen“. Falkenberg, zeitlebens Sympathisant von Bewegungen wie Occupy Wall Street und Attac, schüttelt den Kopf. „Es ist absurd, wenn Ostdeutsche denken, dass die AfD sie versteht.“ Noch absurder sei, wenn deren Funktionäre, oft im Westen geboren, die Probleme des Ostens in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken versprächen.
Falkenberg hat kein Verständnis dafür. Der Musiker, der mit Stern Meißen und seinem Solo-Debüt „Traumarchiv“ eine Million Platten verkaufte, hat selbst die Erfahrung machen müssen, wie mit dem Ende der DDR Lebensleistungen entwertet wurden. „Die Lieder meiner Kollegen aus den alten Bundesländern laufen auch in den Radiosendern in Ostdeutschland rauf und runter“, konstatiert er.
„Die Lieder von uns Ostkollegen dagegen werden in 20 Jahren vergessen sein, weil sie einfach nirgendwo mehr stattfinden.“ Mit dem Austausch des Spitzenpersonals in den Medien sei vor 30 Jahren ein Austausch der kulturellen Vorprägung einhergegangen. „Natürlich spielen Sender im Rheinland Gruppen aus der Region“, sagt er gallig. „und Sender hier bei uns tun das auch - sie spielen Musik von Gruppen aus dem Rheinland.“
Falkenberg macht Rock mit wortmächtigen Texten
Es ist eigentlich zum Verzweifeln, denn seine 50 Konzerte im Jahr sind voll. Es kommen alte Fans von früher, aber eben auch viele junge Leute, die ihn erst entdeckt haben, als er nicht mehr der Popstar, sondern der Liedermacher war. Falkenberg hat sich mit der Situation abgefunden, die für ihn und seine Kollegen auch eine existenzielle Seite hat. „Wir leben ja von unserer Kunst“, sagt er. Aber schlimmer sei doch der andere Aspekt: „Es ist kulturelles Erbe, das verschwinden wird.“
Der Sänger und Komponist, der mit „Mann im Mond“ einen der größten Hits der DDR-Popgeschichte schrieb, hat sich mit seinen wortmächtigen Texten und einem Rock zwischen Neil Young und The National eine Nische geschaffen, in der er sich wohlfühlt. „Ich mache meine Songs so, wie ich sie gern von anderen hören würde“, sagt er, „und es gibt niemanden, der mir reinredet“.
Keine Kompromisse, keine Halbheiten, keine „Industriemusik“, wie er es nennt, die auf maximale Vermarktung programmiert ist. Neulich habe er, sagt er, in einem Modeladen ein T-Shirt mit dem Gesicht des Revolutionärs Che Guevara gesehen. „Der Kapitalismus ist schneller als alle, die ihn abschaffen wollen.“
Fallen oder Fliegen
Falkenberg hat sich für einen Weg entschieden, der Musik nicht als Ware denkt, sondern als Angebot zur Auseinandersetzung. Das Publikum ist kleiner, aber es hört zu. „Ich hör’ sie immer noch sagen, du solltest besser lernen, mit den Skrupellosen zu paktieren und wie sie zu sein“, heißt es in „Fallen oder Fliegen“, das von dieser Lebensentscheidung zwischen Hassen oder Lieben, Dienen oder Leben und eben Fallen oder Fliegen handelt.
Es ist eine Hymne, die das Knien verweigert, die die Immer-mehr-Logik ignoriert und festhält an Werten, die mit Geld nicht zu bezahlen sind. Es zählt nur die Hoffnung, das Glück zu finden, wo es auf einen wartet. „Ich bin zum Beispiel einfach glücklich, weil mir niemand vorschreiben kann, was ich tun soll.“
Falkenberg stellt sein Album am 7. September im Objekt 5 in Halle vor. (mz)