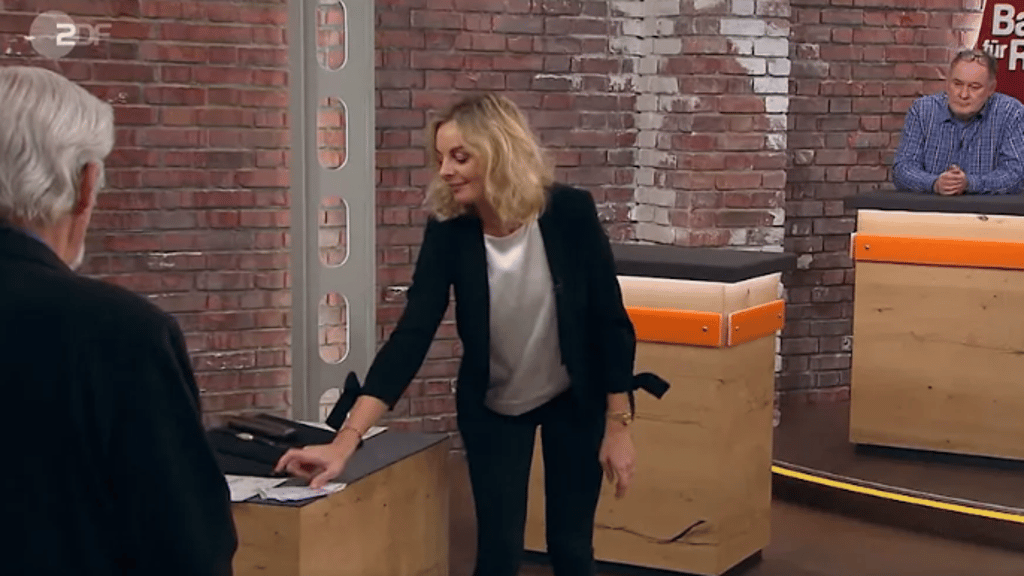Margaret Atwoods Apokalypse: «Das Jahr der Flut»
Berlin/dpa. - Das Jahr 25 ist «Das Jahr der Flut». Nur wenige Menschen haben überlebt. Was genau? Das wird erst spät klar in dem gleichnamigen neuen Roman der Kanadierin Margaret Atwood.
Denn weder Tsunamis, Orkane noch andere Naturkatastrophen oder Kriege sind die Ursache für die Fast-Ausrottung der menschlichen Spezies. Die Natur wächst und gedeiht auch nach der «wasserlosen Flut». Einzig die Menschheit wird dahingerafft. Als göttliche Strafe für alles Böse, ähnlich der Sintflut? Atwood zieht Parallelen und Verbindungen zur biblischen Geschichte - und entwickelt gleichzeitig grausige Visionen, die der Apokalypse in nichts nachstehen.
In Rückblicken einer Handvoll Überlebender beschreibt Atwood die Zeit vor der «wasserlosen Flut»: Eine nicht näher benannte Stadt in den USA ist Schauplatz der Handlung. Die Gegend wird terrorisiert von den CorpSeCorps, ursprünglich Sicherheitsdienste, die aber nach und nach die Macht übernommen haben. Sie kontrollieren die Bevölkerung mit einem Überwachungssystem, das nur wenige Lücken lässt. Diese werden von rivalisierenden Straßengangs für Raub, Vergewaltigung und Mord ausgenutzt.
In Wissenschaftszentren, in denen Experten ungeheuerlichen Genversuchen an Mensch und Tier nachgehen, leben die Beschäftigten noch einigermaßen geschützt. Doch diese Sicherheit ist trügerisch. Eine Enklave gibt es noch in dieser trostlosen und brutalen Welt: den Dachgarten Eden, das Paradies der Gärtner Gottes. Der Kopf der Sekte, Adam eins, sagt die «wasserlose Flut» voraus und besteht darauf, dass sich die asketisch und vegetarisch lebenden Bewohner ihren eigenen Ararat zulegen. Der Name, benannt nach einem Berg in der Türkei, auf dem die Arche Noahs nach der Sintflut gelandet sein soll, dient hier als Synonym für Vorratslager.
Wer es schon geahnt hat, erhält in der zweiten Hälfte des Romans Gewissheit: Die «wasserlose Flut» ist eine Seuche - verursacht durch Mensch und Genmanipulation. Nur wenige bleiben davon verschont. Doch was für ein Leben wartet jetzt auf sie? Margaret Atwood lässt Spekulationen zu. Das Endzeitepos macht nachdenklich. Aber das ist auch schon alles. Der große Wurf ist der preisgekrönten Autorin, die am 18. November ihren 70. Geburtstag feiert, mit «Das Jahr der Flut» nicht gelungen. Weder sprachlich noch inhaltlich reicht das neue Buch an ihren Erfolgsroman «Oryx und Crake» (2003) heran.
Das Szenarium ist gruselig, der Roman aber eher langweilig. Es kommt kein richtiger Fluss in die Handlung. Abwechselnd berichten die Hauptakteure Adam eins, Toby und Ren über den Status quo oder die Zeit davor. Während Adam eins (christlich) moralisierend seine Schäfchen beisammen hält, setzen sich Toby und Ren mit Anarchie, Kriminalität, Kannibalismus, Triebtätern und anderen verkommenen Subjekten sowie neu geschaffenen Untieren auseinander.
Die von Atwood gezeichnete Zukunft ist möglicherweise nicht einmal so realitätsfern. Hausgemachte Naturkatastrophen, leichtsinniger Umgang mit Genmaterial, Vogel- und Schweinegrippe sind nur einige Alarmsignale der heutigen Zeit, die beim Lesen in den Sinn kommen. Nur, wie die Autorin das Thema umgesetzt hat, ist holprig und mitunter mit Fakten überladen. Ihre visionäre Kraft, ihre Warnung vor Umweltzerstörung und fehlgeleitetem Wissenschaftszwang gehen dabei leider etwas unter.
Margaret Atwood
Das Jahr der Flut
Berlin Verlag, Berlin
476 S., 22,00 Euro
ISBN: 978-3-8270-0884-8