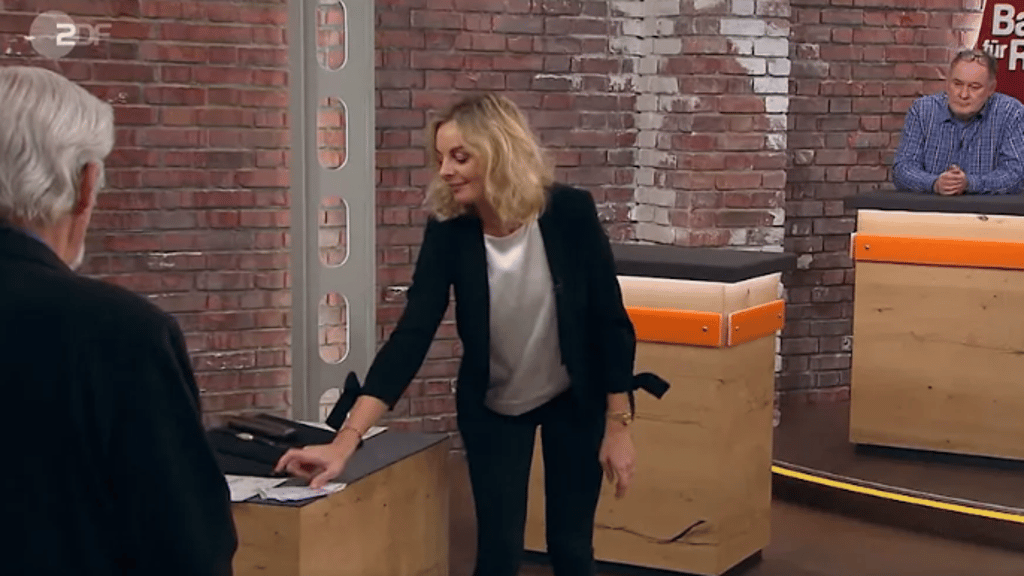Kunst und Reformation Kunst und Reformation: Cranach satt in Thüringen

Weimar/Gotha/Eisenach - Die Freundschaft zwischen Luther und Cranach ist vielfach belegt. Luther war Taufpate bei Cranach, Cranach war Trauzeuge für Luther. Luther predigte gegen Karlstadt, als der in Wittenberg einen Bildersturm lostrat. So rettete er letztlich Cranachs äußerst einträgliche Geschäftsgrundlage, aber das erklärt die treuliche Verbindung der beiden Männer sicher nicht allein.
Zumindest eine Facette könnte diese Freundschaft in den drei Ausstellungen sein, mit denen Weimar, Gotha und die Wartburg den Auftakt zum Cranach-Jahr mit dem Thema „Bild und Bibel“ machen, die vorletzte Jahresstufe der „Lutherdekade“.
Aus dem Vollen schöpfen
Konkreter Anlass aber ist der 500. Geburtstag des zweitältesten Cranach-Sohnes, also Lucas des Jüngeren. Das stiftet nun einige Verwirrung, denn von den 16 Ausstellungen in neun Städten widmet sich nur eine, in Wittenberg vom 26. Juni bis 1. November, ausschließlich (und erstmals) dem Jüngeren.
Aber wer Cranach hat, der schöpft aus dem Vollen. Weimar und Gotha haben die Fülle der ehedem fürstlichen Sammlungen und Eisenach die im 19. Jahrhundert aufgebaute der Wartburg-Stiftung. Zusammengezählt zeigen die Ausstellungen rund 460 Exponate, bei weitem die meisten aus je eigenem Bestand. Wer sich für alle drei Orte die Zeit nimmt, wird sich bald fragen, warum das nicht Stoff für eine große Landesausstellung hätte sein können. Die Verantwortlichen sagen, dass es in Thüringen dafür keinen geeigneten Standort gibt.
Mag sein, aber viel Zusammenarbeit gab es offenbar auch sonst nicht, wie es die Doppelungen zeigen, mit gesondertem Forschungsaufwand, und teils hier, teils da erzählten Geschichten. Zum Beispiel Cranach als Propagandist der Reformation: Das ist Schwerpunkt in Gotha und bildhaft inszeniert mit „fliegenden Blättern“. Weimar setzt die Gewichte anders, verzichtet aber auf diesen Aspekt nicht, mit einigen derselben Exponate.
Oder die Luther-Porträts: Die Wartburg sichtet akribisch die mit dem Reformator betriebene Bildnispolitik, und identifiziert sieben, jeweils in der Zeit bedeutsame Stile und Botschaften – wobei der Text an den Wänden leider mehr Raum einnimmt als die Bilder. Aber auch Weimar und Gotha zeigen ihre Luther-Porträts in Öl und auf Papier und deuten sie ganz ähnlich. Wirklich bedauerlich ist das getrennte Marschieren aber da, wo dank der Bildpolitik jener Jahre auch ein einschneidendes politisches Geschehen greifbar wird. Gotha zeigt in epischer Breite, wie der „Schmalkaldische Bund“ sich als „Kämpfer gegen Tyrannen“ inszeniert: mit Cranachs drastischen Bildern von Judith mit dem abgeschlagenen Kopf des Holofernes oder dem gleichfalls abgetrennten Haupt des Johannes.
Weitere Informationen lesen Sie auf Seite 2.
Weimar nimmt den Faden 1546 mit der Niederlage und der Gefangennahme Kurfürst Johann Friedrichs im Schmalkadischen Krieg auf, und stellt die Kapitulationsurkunde aus, herrisch signiert vom Kaiser, krakelig vom Verlierer. Und aus dem Prado kommt passend dazu die unverhohlene Demütigung im Porträt von Karls Hofmaler Velazquez: Er zeigt den Gefangenen in jämmerlicher Gestalt, aller Insignien entkleidet, mit einer Narbe im Gesicht. Später aber, so zeigen es wieder beide Orte, wird Cranach aus dem Geschlagenen den protestantischen Märtyrer machen, der die Narbe stolz zur Schau stellt.
Dem Vater ebenbürtig
Für Weimar ist die kunsthistorisch spektakuläre Folge dieser Ereignisse der Flügelaltar in der Stadtkirche. Er ist endgültig von dem zählebigen Mythos befreit, dieses glanzvolle Propagandabild von der heilsgeschichtlich siegesgewissen Reformation sei noch von Lucas Cranach dem Älteren begonnen und von seinem Sohn vollendet worden.
Das Original ist freilich zu groß und zu würdig, um es ins Schiller-Museum zu transportieren. Aber selten zeigt sich eine Medienstation so sinnvoll, wie die am Eingang präsentierte, mit der der ganze Kosmos dieses Meisterwerks bis ins feinste, filigran gemalte Detail heranzuzoomen ist. Der Cranach-Sohn, mag seine Werkstattproduktion auch uferlos und schwankend gewesen sein, bietet hier ein dem Vater ebenbürtiges Können auf.
Kühnheit der Bildaussage
Ebenso frappierend ist die Kühnheit der Bildaussage: Er stellt den verstorbenen Vater ins Heilsgeschehen, zwischen dem ebenfalls längst toten Luther und Johannes dem Täufer, und lässt ihn den Blutstrahl der Gnade vom Gekreuzigten auffangen, weil er als Maler Luthers Erkenntnis von der Erlösung im Glauben dereinst sichtbar gemacht hat. Die Nachfolgegeneration der ernestinischen Beschützer der frühen Reformation sind als Stifter ihren Vorfahren gleichgestellt: Die Reformation, soll das heißen, steht nach wie vor unter dem Schutz des Fürstenhauses.
Man muss sich wieder nach Gotha begeben, um die Bilderfindung, die Cranach der Jüngere so lebendig fort- und umgesetzt hat, in den ersten „Gesetz und Gnade“-Bildern seines Vaters zu studieren, wofür das früheste von 1529 als kostbare Leihgabe aus Prag kommt. Luther und Cranach haben gemeinsam dieses letztlich sehr didaktische „Programm“-Bild erdacht: Ins Fegefeuer wandert, wer in eifriger Erfüllung des mosaischen Gesetzes Gott zu gefallen meint, und wird dagegen vom Erlöser empfangen, wer bedingungslos an ihn glaubt. Am stärksten spricht das Ergebnis dieser Freundschaft in den Porträts auf der Wartburg. Zwar hat Cranach Luther immer wieder als Bildtypus erfunden und ein bis heute tragendes Image von ihm geschaffen, aber mit zwei frühen Kupferstichen sind auch quasi unverstellte Eindrücke von dem jungen, rebellischen Mönch und dem Tatendrang ausstrahlenden „Junker Jörg“ gegenwärtig: der Weltumstürzler Luther, in Cranachs Federstrich lebt er.
Wartburg, bis 19.7., tgl. 8.30-17 Uhr, Katalog 12,95 Euro; Gotha, Herzogl. Museum, bis 19.7., tgl. 10-17 Uhr, Kat. 24,95 Euro; Weimar, Schiller-Museum, bis 14.6., Di-So 9.30-18 Uhr, Kat. 23 Euro (mz)