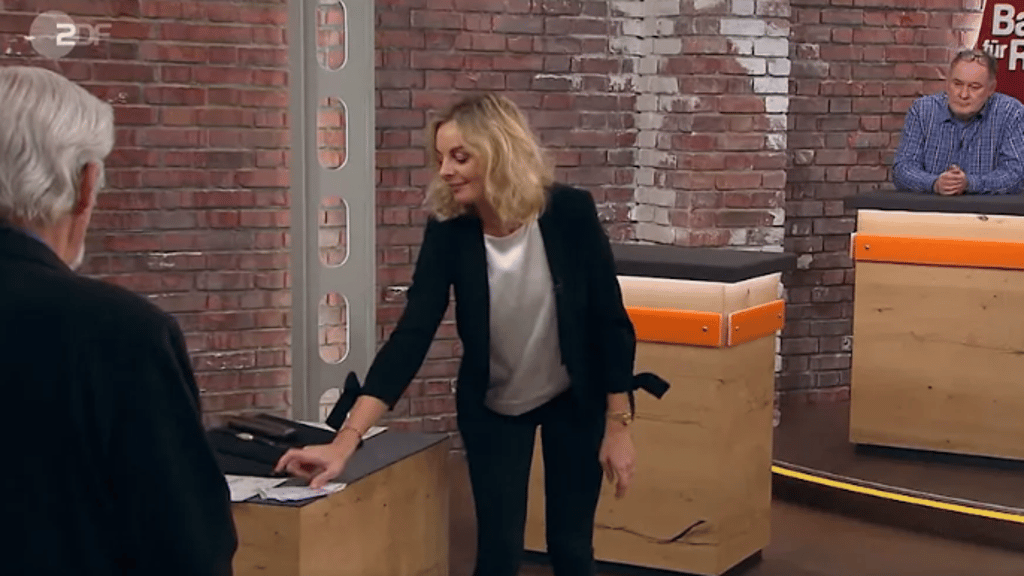Kulturpolitik Kulturpolitik: Trotzkopf oder Taktiker
Berlin/dpa. - Der «einsame Trotzkopf», wie eine Zeitung Flierl nannte, ließ sich- bisher - nicht beirren, zumal seine Partei schon aus Gründen desMachtgefüges in der Koalition noch an ihm festhalten wird, wenn auchFlierl Kritiker in den eigenen Reihen hat. Aber das soll in anderenParteien ja auch vorkommen.
Schon im Laufe des Jahres waren die Schlagzeilen für denKulturpolitiker nicht immer schmeichelhaft: «Die Autorität Flierlsschwindet», lautete eine im Juli, «Berliner Kultursenator taktiertsich ins Aus», eine andere im November. Flierls Amtsjahr endeteschließlich mit der heftig umstrittenen und auch unglücklichgelaufenen Installierung eines Stasi-belasteten Generaldirektors derneuen Opernstiftung, der damit allen drei Berliner Opernhäusernvorstehen soll. Er war nicht die erste Wahl Flierls. Sein «opusmagnum» war seit seiner Gründung vor einem Jahr führerlos, die großenNamen waren nicht mehr an die Spree zu locken, um sich in die dortmassenhaft ausliegenden tückischen kulturpolitischen Netze zuverstricken.
Den negativen Höhe- und Schlusspunkt setzte dann in den letztenTagen des turbulenten kulturpolitischen Jahres in Berlin derüberraschende Rückzug des Schriftstellers Christoph Hein alsdesignierter Intendant des Deutschen Theaters. Das traditionsreiche,früher von Max Reinhardt geführte Haus in Nachbarschaft von Charitéund Berliner Ensemble ist nach der Schließung des Schiller-Theaters1993 das Theater-Flaggschiff der Hauptstadt mit nationalem Anspruch.
Kritik wird vor allem an Flierls angeblicher Neigung zu einsamenPersonalentscheidungen geübt. Die Berliner Parlamentsoppositionspricht von «Stümperei» und «Auswahlverfahren voller Intrigen,Spitzeleien und Winkelzügen». Flierl verstehe es nicht, Mehrheitenfür seine Ziele hinter den Kulissen zu bilden.
In manchen kritischen Kommentaren ist gar von einer«Götterdämmerung» in der Berliner Kulturpolitik die Rede, da sich dasAnsehen Flierls mit dem Schicksal eines der größten deutschsprachigenTheaterbetriebes zu verbinden scheine. In der Tat ist es dem früherenBaustadtrat von Berlin-Mitte nicht gelungen, namhafte Vertreter derTheaterlandschaft für dieses renommierte Haus ernsthaft zuinteressieren. Im auffälligen Kontrast dazu steht Flierls großesWohlwollen für eine weitere Nutzung der Bauruine des Palastes derRepublik mit teilweise zweifelhaften Veranstaltungen.
Auf anderen Feldern kann sich Flierls Bilanz durchaus sehenlassen. Die starke Einbindung des Bundes in die BerlinerKulturlandschaft bis hin zum Wiederaufbau der Museumsinsel ist nichtzuletzt seinem Geschick zu verdanken, auch wenn da immer noch Wünschewie die Übernahme der Staatsoper Unter den Linden offen bleiben. AberKultursenator in der Hauptstadt bleibt ein Schleudersitz, das habenschon seine sechs Vorgänger seit der Wende erfahren müssen, ob CDU-Politiker wie Peter Radunski und Christoph Stölzl, die Grüne AdrienneGoehler oder der parteilose Ulrich Roloff-Momin. Von ähnlich kurzerDauer waren übrigens auch die Amtszeiten der bisherigenKultur-Staatsminister auf Bundesebene.