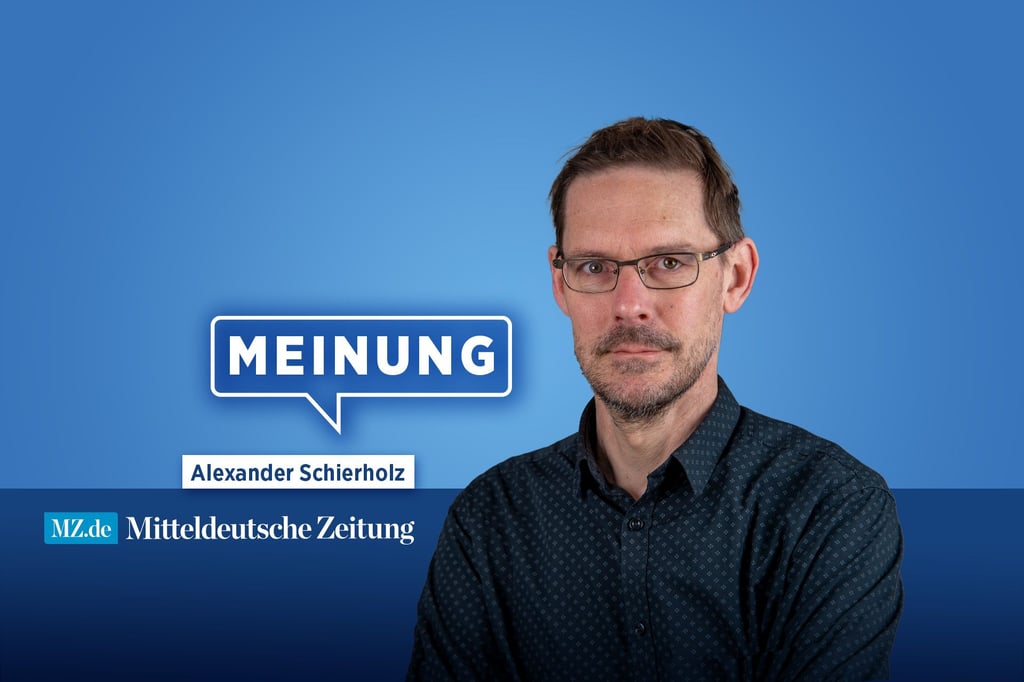Kritik an Donnersmarck Kritik an Donnersmarck: Darum zerpflücken Christoph Hein und Gerhard Richter DDR-Filme
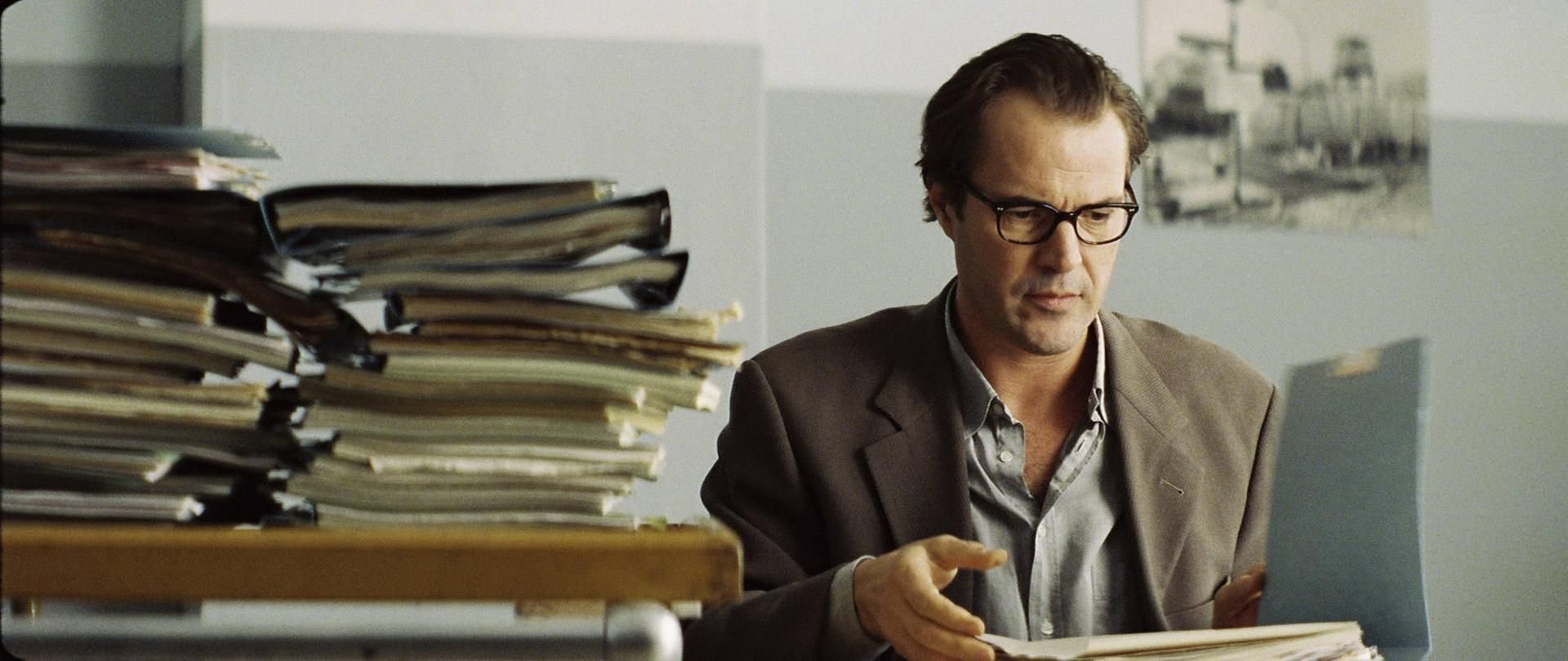
Halle (Saale) - „Gegenlauschangriff“ heißt das neue Buch von Christoph Hein, das Anfang März bei Suhrkamp erscheint. Kein Roman diesmal, sondern eine Sammlung kleiner Prosastücke, die als „Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege“ präsentiert werden.
Die Richtung des Buches, das der Verlag als Heins „persönlichstes“ ankündigt, ist klar: Es geht um Lebens- und Zeitgeschichte, um Ost und West, dargeboten in kleiner, aber keinesfalls gemütlicher Prosa. Die Anekdote verknappt das Erzählte auf das Wesentliche, sie greift auf und an - und spitzt zu.
Und das mit Erfolg. Denn der „Gegenlauschangriff“ hat bereits begonnen. Unter der Zeile „Mein Leben, leicht überarbeitet“ druckte die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag vergangener Woche einen Text aus dem Buch, in dem Christoph Hein erklärt: „Warum ich meinen Namen aus dem Vorspann des Filmes ,Das Leben der Anderen’ gleich nach der Premiere habe löschen lassen“.
„Machwerk“: Auch Gerhard Richter distanziert sich von Donnersmarck-Film
Eine Veröffentlichung zur rechten Zeit. „Werk ohne Autor“, der neue Film von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, wurde als „bester nicht-englischsprachiger Film“ für den Oscar nominiert. Ein zweites Mal nach „Das Leben der Anderen“ hatte sich der Rheinländer eines Ost-Stoffes bedient, der Effekt macht.
Den versprach nach der Stasi der aus Dresden stammende Maler Gerhard Richter, der teuerste Maler der Gegenwart, dessen Leben sich Donnersmarck von ihm selbst erzählen ließ. Heute nennt Richter den Film ein „Machwerk“. Der Regisseur habe es geschafft, „meine Biografie zu missbrauchen und übel zu verzerren“.
„Das Leben der Anderen“: Hein verlangte die Löschung seines Namens aus dem Abspann
Auch Christoph Hein wurde von Donnersmarck besucht. Er wolle einen Film über einen typischen DDR-Dramatiker drehen, habe dieser um Auskunft gebeten, teilt Hein mit. Dass es keinen „typischen“ DDR-Dramatiker gegeben habe, habe der Autor erwidert, so wenig wie ein normatives oder typisches Leben in der DDR.
Er könne ihm aber von seinem eigenen Autorenleben erzählen. Nach vier Stunden bedankte sich der Zuhörer: Jetzt wisse er alles über den Osten und darüber, wie es in der Diktatur zugegangen sei.
Als Hein 2005 den Film gesehen und seinen eigenen Namen in der den Beratern gewidmeten Dankschleife entdeckt hatte, schrieb er dem Regisseur einen Brief. Er verlangte, dass sein Name gelöscht werde, denn sein Leben sei ganz anders gewesen, als im Film dargestellt.
Hein: „das ist bunt durcheinandergemischter Unsinn“
Es ging Hein nicht darum, dass es schwerfällt, in der Figur des von Sebastian Koch gespielten Dramatikers Georg Dreymann die eigene Gestalt zu erkennen; man darf hinzufügen, überhaupt irgendeines Ost-Schriftstellers: Koch ist in seiner rosawangigen Wohlgeratenheit völlig DDR-Literaten-untypisch.
Hein störte, dass der Film nicht zeigt, was er verspricht: die 1980er Jahre. Kein Manuskript musste mehr in Agentenmanier in den Westen geschmuggelt werden. Kein prominenter Autor musste dramatisch seine Schreibmaschine verstecken: „das ist bunt durcheinandergemischter Unsinn“.
Die Lage sei längst eine andere gewesen. „Der Staat bekam allein mit Repressionen seine Untertanen nicht mehr in den Griff, die Ausreiseanträge mehrten sich, viele geschätzte Künstler verabschiedeten sich für immer, die Grenze wurde durchlässiger.“ Heins Befund: „der Film ist ein Gruselmärchen, das in einem sagenhaften Land spielt, vergleichbar mit Tolkiens Mittelerde.“
Kritik an der Kritik: Hein gerät ins Schussfeld
Darf das so stehen bleiben? Am Dienstag reagierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Hein, anmoderiert mit der Unterzeile: „Von Wahrheit und Lüge im zynischen Sinne“. Es gibt keinen Vorspann in Donnersmarcks Film, enthüllt das Blatt. Es gibt einen Nachspann, und in dem wird Hein als einer von 13 Beratern genannt, und zwar als letzter. Also: Vorsicht bei diesem Autor!
Hein, der zur Zeit Gast der Buchmesse in Kairo ist, mailte der Süddeutschen Zeitung in Sachen Vorspann: „in dieser ,Kernfrage’ will ich nach einem Jahrzehnt gern einen Irrtum einräumen“.
Was aber ist der Kern? Die Frankfurter stellen fest, dass es sich bei dem Film, der sich gar nicht auf eine „wahre Geschichte“ berufe, um eine „qua Gattung ausgewiesene Fiktion“ handele. „Ein Schriftsteller wie Hein sollte wissen, was das bedeutet.“
Aber was? Etwa, dass Fiktion nicht mit „Wirklichkeit“, also nicht mit historischer Genauigkeit vereinbar sei? Das wäre grober Unfug. Oder dass Fiktion, die sich ein zeitgeschichtliches Thema sucht, auf historische Genauigkeit verzichten müsse, um irgendeine Wirkung zu retten? Aber genau das tat doch in großen Teilen die DDR-Literatur.
Abnehmendes Licht
Und das hat nie aufgehört, wenn preiswürdig von der DDR die Rede ist. Nicht zufällig bieten die mit einem Deutschen Buchpreis zu Bestsellern beförderten Bücher märchenhaft gewirkte Texte. Es sind Romane, die Milieu-Illusionen bedienen. Das Beschwören eines Ost-Bürgertums, das aber schon vor 1961 sozial gebrochen war in Uwe Tellkamps „Der Turm“.
Die Erfindung eines politikfernen poetischen Außenseitertums in Lutz Seilers „Kruso“. Die Behauptung eines guten kommunistischen Anfangs in Eugen Ruges Nomenklatura-Epos „In Zeiten des abnehmenden Lichtes“. Bücher, die eine DDR zeigen, wie sie gewesen sein könnte. Und in der Erinnerung irgendwann gewesen sein wird.
Christoph Hein erzählt in seiner Anekdote von einem Germanistik-Professor, der Heins berühmte, 1987 auf dem DDR-Schriftstellerkongress gehaltene Anti-Zensur-Rede mit Studenten las. Die belehrten ihren Professor, dass dieser kompromisslose Text gar nicht von 1987 stammen könne. Das sei unmöglich. Sie wüssten es ganz genau, weil sie „Das Leben der Anderen“ gesehen hätten. Das klingt so wahr, dass es ausgedacht sein muss. (mz)