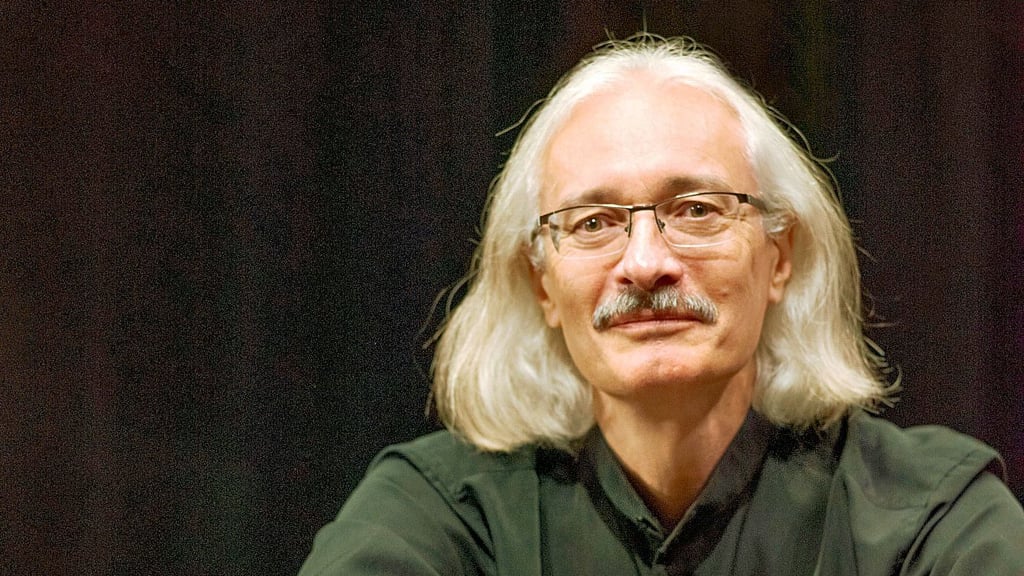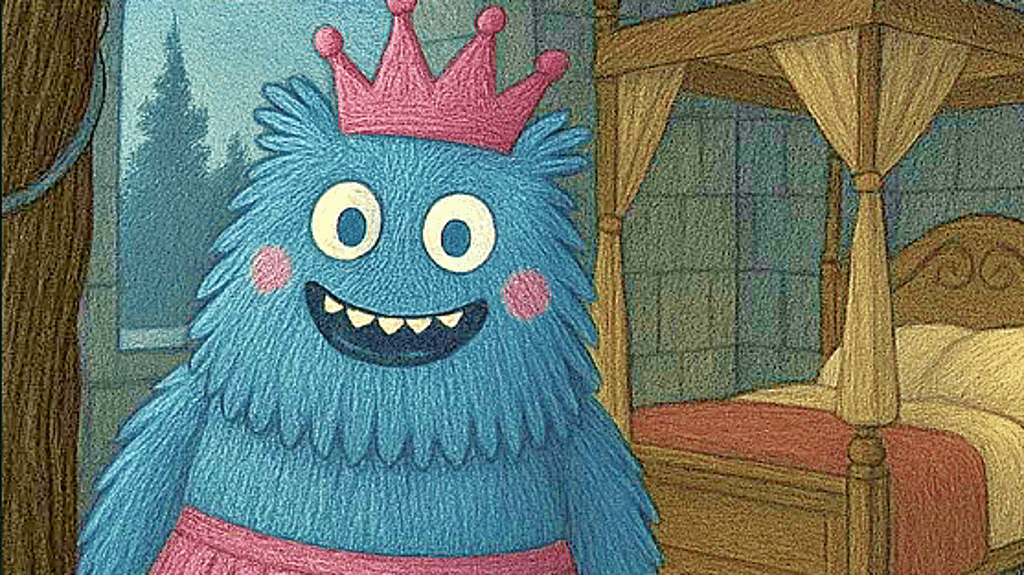Joseph Haydn Joseph Haydn: Das kopflose Ende eines fröhlich frommen Lebens
HALLE/MZ. - Die Nationalhymne, die Joseph Haydn 1797 auf den Text "Gott erhalte Franz, den Kaiser" komponierte, ist lediglich durch den Text von Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 zum "Lied der Deutschen" umgewidmet worden - und war bei der ersten Kür zur offiziellen Hymne 1922 auch erst seit vier Jahren von ihrer Funktion als Statussymbol der Nachbarn befreit.
Ihr Komponist aber, dessen Todestag sich am Sonntag zum 200. Mal jährt, war ein treuer Diener der Fürsten in Österreich und Ungarn. Als Sohn eines Stellmachers 1732 im niederösterreichischen Rohrau geboren und als Achtjähriger für den Knabenchor des Wiener Stephansdoms entdeckt, erhielt er früh umfassenden Musik-Unterricht - und musste sich nach dem Stimmbruch zunächst als Kammerdiener und Klavierlehrer verdingen. Erst mit 25 Jahren fand er seine erste Stelle als Musikdirektor des Grafen Morzin, vier Jahre später begann seine fruchtbarste und glücklichste Periode am Hof der Familie Esterházy.
Hier - in der Residenz in Eisenstadt, dem Winterpalast in Wien und dem neuen Schloss Esterháza - konnte Haydn seinen Stil entwickeln und die eigenen Werke mit einem eigenen Orchester praktisch ausprobieren. Bis zu 150 Dirigaten fielen pro Saison an, daneben mehrten sich die Auftragswerke für andere Kunden, für die u. a. die "Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" und die Pariser Sinfonien entstanden. Aus den späten Jahren im Dienste des Fürsten datiert auch die Freundschaft mit Wolfgang Amadeus Mozart, der wie Haydn Freimaurer war und ihm eine Serie von Streichquartetten widmete - womit er sich zugleich vor der Meisterschaft Haydns im Schreiben für diese Besetzung verneigte.
Dass er den 17 Jahre Jüngeren um 18 Jahre überlebte, hat Haydn in der Rezeption der Nachwelt nur wenig genützt. Der Musiker, der aus dem Spätbarock kam und die Wiener Klassik zu einer ersten hohen Blüte führte, wurde schon zu Lebzeiten mit dem gemütlichen Kosenamen "Papa Haydn" bedacht, der ihm innovative Kraft und Originalität absprach. Dabei hatte er die Suche nach einer eigenen Klangsprache, die durch die Entfernung zu den musikalischen Zentren eher erschwert wurde, selbst ganz anders beschrieben: "Ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irremachen und quälen, und so musste ich original werden."
Wie gut ihm das gelungen war, durfte er im relativ hohen Alter auf umjubelten Konzertreisen nach England erfahren: Nach seiner Pensionierung durch einen amusischen Esterházy-Nachfahren wurde Haydn von einem deutschen Impresario 1791 nach London geschickt, wo er für seine Kammermusik und seine Sinfonien gefeiert wurde. Um Zugaben musste er sich dabei keine Gedanken machen: Auf sein Konto gehen allein 104 Sinfonien, 14 Messen, sechs Oratorien mit so bekannten Titeln wie "Die Schöpfung" und "Die Jahreszeiten" sowie 83 Streichquartette und 126 Baryton-Trios. Möglicherweise ist es auch dieser schieren Masse zuzuschreiben, dass Haydn lange eher in Quantität als in Qualität wahrgenommen wurde. Auch die meisten seiner 24 Opern, bei denen Titel wie "Acide e Galatea", "Armida" oder "Orlando Palladino" noch die Nähe zum Zeitgeschmack des Barock beweisen, sucht man auf heutigen Bühnen vergebens.
Die gruseligste Pointe lieferte der für seine Frömmigkeit und seine musikalischen Scherze berühmte Komponist allerdings posthum. Als seine einstigen Auftraggeber den 1809 bei einem napoleonischen Angriff auf Wien an Entkräftung gestorbenen Musiker in ihre Heimat umbetten wollten, fehlte im Sarg der Kopf. Ein Anhänger der Gallschen Schädellehre hatte ihn entwenden lassen, erst 1895 wurde das skelettierte Haupt der Gesellschaft der Musikfreunde ausgehändigt. Und seit 1954 ruht der Kopf dort, wo auch die Gebeine beigesetzt sind: in der Haydnkirche von Eisenstadt in Österreich.