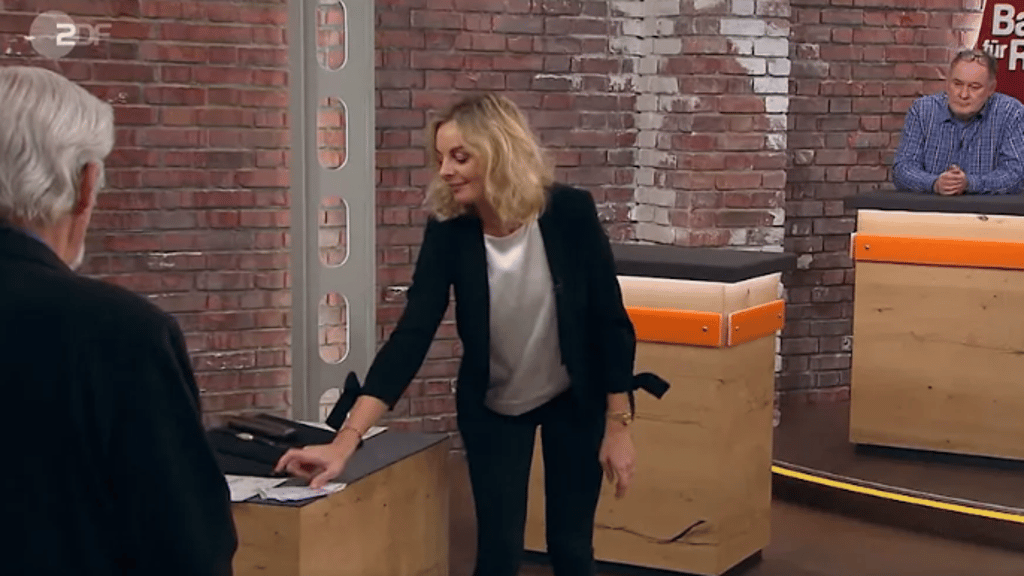Dirigent Dirigent: «Das ist demütigend» Sagen Sie mal... Kent Nagano
Halle (Saale)/MZ. - Dass ihm die Frauen zu Füßen liegen, wird in jedem Porträt betont, und weil die Welt der Klassik nicht erst seit unseren Tagen ihre Stars nach gleichen Mustern auf- und abwertet wie die des Pop, stand die Kunst Naganos nicht selten genau deswegen unter besonders kritischer Beobachtung.Sein Repertoire sei eingeschränkt, an Beethoven und Mozart habe er sich zu spät gewagt und dann nur wenig überrascht. Ein Sängerdirigent sei er schon gar nicht, weswegen sich vor allem die Deutschen an seinen Wagner-Interpretationen scheiden. Seine Bewunderer wiederum schätzen die Seriosität, die unbedingte Werktreue, seinen Dienst am Komponisten. Der US-Amerikaner polarisiert, seit er in den 80er Jahren als Chefdirigent des Boston Symphonic Orchestra aufhorchen ließ. Er selbst versteht sich in erster Linie als Traditionalist, nicht als bloßer Bewahrer, eher als Forscher.
Wenige Stunden vor unserem Gespräch ist ihm die Bayerische Europamedaille verliehen worden, für besondere Verdienste um Bayern in einem Vereinten Europa, wie es offiziell heißt. Er ist stolz auf diese Auszeichnung, vielleicht auch, weil sich seine erfolgreiche Zeit in München unharmonisch ihrem Ende zuneigt. Nach einem offenen Disput mit Intendant Nikolaus Bachler, seinem exaltierten, experimentierfreudigen Antipoden, hatte er sich Rückendeckung aus dem Kunstministerium erhofft. Sie blieb aus. Nagano, Wahl-Europäer mit Wohnsitz in Paris und London, wird 2013 weiterziehen.
Das Interview führte Mark Obert.
Mr. Nagano, gibt es so etwas wie einen "European Way of Life"?
Kent Nagano: Wow, komplizierte Frage.
Warum?
Kent Nagano: Weil sich Gesellschaften unentwegt verändern, weiterentwickeln, schon allein wegen der vielen Einflüsse durch andere Kulturen. Tja, ich weiß nicht . . . Warum fragen Sie?
Weil wir Europäer zurzeit über unser Verhältnis untereinander nur noch in Bezug auf den Euro meditieren. Weil wir unser Parlament in Brüssel als bürokratisches Monster wahrnehmen. Weil wir nicht wissen, wo nationale Interessen aufhören und europäische beginnen. Weil wir nicht wirklich wissen, was uns eint.
Kent Nagano: Trotz oder gerade wegen dieser großen Debatten sollte man nicht zu schätzen vergessen, dass innerhalb der Europäischen Union seit mehreren Jahrzehnten Frieden herrscht. Als ich als junger Mann nach Europa gekommen bin, vor gut 40 Jahren, war der Gedanke eines friedlichen Europas, wie wir es heute als selbstverständlich betrachten, noch ganz jung, und niemand hätte doch annehmen können, dass es einmal so gut funktionieren würde. Dass dieser Einigungsprozess ein stetig dynamischer sein würde und von daher allein schon konfliktreich, liegt in der Natur der Sache. Nun ja, eine Antwort auf Ihre eigentliche Frage ist das nicht. Aber ich verstehe Ihre Intention: Sie zielen auf den Blick von außen ab.
Auf den Blick des US-Amerikaners mit japanischen Wurzeln. Weil ja umgekehrt fast jeder Europäer eine Auffassung vom "American Way Of Life" hat.
Kent Nagano: Das sind doch Stereotype. So wie viele Amerikaner und Europäer auch ein bestimmtes Lebensgefühl mit Kalifornien verbinden, wo ich aufgewachsen bin. Das sind auch nur Klischees, die erstens nur auf einen ganz kleinen Küstenstreifen Kaliforniens zutreffen, wenn überhaupt.
Das Beach-Boy-Feeling: Sonne, Strand, Surfen, die Leichtigkeit des Seins.
Kent Nagano: So ungefähr. Zwischen Los Angeles und San Diego mag es Strände geben, an denen so oder so ähnlich gelebt wird, aber schon in meiner Heimatregion bei Morro Bay ist das ganz anders. Dort, auf ungefähr halber Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco, stürzen mächtige Berge in den Pazifik, ist das Wasser durch die von Alaska kommenden Ströme so kalt, dass sie nur kurz darin baden können. Es ist eine dramatische Natur. Mittlerweile ist es zwar milder geworden, wahrscheinlich wegen des Klimawandels, aber die Menschen dort sind bis heute ein anderer Schlag als die im Süden Kaliforniens.
Wie sind die Menschen dort?
Kent Nagano: Nicht so extrovertiert, bedächtiger. Aber nicht im Sinne von rückständiger. Weil die Region eine Art Auffangbecken von Einwanderern war, war ihre Gesellschaft nach den großen Einwanderungsbewegungen Ende des 19. Jahrhunderts und im Zuge der Weltkriege ausgesprochen kosmopolitisch: Italiener, Deutsche, Russen, Franzosen . . . Ich erinnere mich, wie in meiner Kindheit bald jede Woche in der Nachbarschaft ein anderer nationaler Feiertag gefeiert wurde. Das waren meine ersten Eindrücke von Europa.
Klingt eher nach Folklore.
Kent Nagano: Auch, natürlich.
Was mögen Sie besonders an Europa.
Kent Nagano: Eben das: die kulturelle Vielfalt, das Traditionsbewusstsein, die Authentizität, die ich als Musiker allerdings in erster Linie auf mein Fach beziehe. Ich hatte als Kind einen Musiklehrer, der vor dem Zweiten Weltkrieg als politischer Flüchtling in die USA ausgewandert war. So kam ich früh in Kontakt mit der deutschen und der russischen Schule, mit einer Form von Musikerziehung, wie es sie heute in den USA kaum mehr gibt. Die Auseinandersetzung mit den Komponisten war schon intensiv, aber mir fehlte etwas, mir schien alles nur indirekt. Die Distanz zwischen der kalifornischen Provinz und Europa war zu groß, als dass ich mir von dort aus das erstrebte Verständnis für die Werke hätte erschließen können. Als ich dann endlich nach Europa gekommen bin, viel später, als ich gewollt hatte, war das für mich in vielerlei Hinsicht erhellend.
Sie haben Olivier Messiaen kennen gelernt.
Kent Nagano: Und andere zeitgenössische Komponisten, deren Werke auf denen der früheren Komponisten aufbauen, womit ich über den unmittelbaren Zugang zur zeitgenössischen Musik all das lernte, was ich für meine Arbeit mit alter Musik brauchte. Wie man die Literatur eines Landes am besten verstehen lernt, wenn man seine Sprache kann, war für mich auch das Erlernen der Sprachen wesentlich, um Originalquellen zu studieren.
Der Sehnsuchtsort Europa hat also gehalten, was Sie sich versprochen haben?
Kent Nagano: Absolut.
Können Sie verstehen, dass für viele Europäer die USA bis heute ein Sehnsuchtsort sind?
Kent Nagano: Warum nicht?
Konkret gefragt: Ist Amerika noch das freie Land, als das es sich so vehement verteidigt?
Kent Nagano: (lacht laut) Entschuldigen Sie bitte, aber wenn wir diese Diskussion jetzt anfangen, sitzen wir heute Nacht noch hier. Wie meinen Sie das überhaupt? Im demokratischen Sinne?
Im Sinne, dass Amerika die Freiheit als absolut setzt und diesem Anspruch in vielerlei Hinsicht selbst nicht gerecht wird.
Kent Nagano: Das müssen Sie erklären.
Die um sich greifende und verheerende Armut zum Beispiel, die systematische Ungleichheit, wie sie die Finanz- und Immobilienkrise deutlicher denn je offenbart.
Kent Nagano: Das ist ein Problem, ohne Frage. Mich hat auch der Fall Strauss-Kahn ins Grübeln gebracht. Die Unschuldsvermutung scheint mir nicht mehr ausreichend berücksichtig in den USA. Für Verdächtige, die sich keine teuren Spitzenanwälte leisten können, ist das dramatisch.
Sie haben mal in einem Fragebogen geäußert, die Stärkung der Schwachen wäre für sie das oberste politische Ziel.
Kent Nagano: Das soll ich gesagt haben?
Im deutschen Nachrichtenmagazin Focus.
Kent Nagano: Klingt gar nicht nach mir, weil es wirklich ein trivialer Allgemeinplatz ist. Jeder einigermaßen humanistisch gestimmte Mensch sollte so denken.
Anderes Beispiel: Der Sicherheits- und Kontrollwahn nach 9 / 11.
Kent Nagano: Da stimme ich Ihnen zu, da wird Freiheit eingeschränkt. Wir haben im Amerikanischen den Begriff Profiling, der aus der Kriminologie stammt. Profiling ist eine Methode zur Bestimmung, zur Charakterisierung eines Tätertyps. Nun ist es so, dass nach 9 / 11 Profile des Typus Terrorist, vor allem islamistischer Terrorist, angefertigt worden sind, und diese Profile scheinen bereits in einem sehr groben Raster zu erhöhter Aufmerksamkeit zu führen. Viele werden zu Opfern dieses maßlosen Sicherheitsdenkens. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Seit 9 / 11 werde ich an US-Flughäfen in vier von fünf Fällen intensiv kontrolliert, nicht nur mein Gepäck, auch mein Körper. Das ist demütigend.
Sie als berühmter Dirigent werden gefilzt?
Kent Nagano: Das zählt doch nicht. Was zählt ist, dass ich als Mann mit japanischen Gesichtszügen offenbar schon ins Grobraster passe . . .
.
. . und folglich behandelt werden wie jeder andere Araber und Asiate auch. Das könnte man nun wieder sehr demokratisch nennen.
Kent Nagano: (lacht) Richtig. Absurd bleibt trotzdem, dass ich als gebürtiger Amerikaner mehr Hindernisse auf dem Weg nach Hause zu überwinden habe als bei der Einreise nach Kanada oder Europa.
Würden Sie das schon Rassismus nennen?
Kent Nagano: Es ist eine Variante davon.
Wie war das im Kalifornien Ihrer Kindheit?
Kent Nagano: Kinder können sehr direkt sein, sehr brutal. Der Angriff der japanischen Luftwaffe auf Pearl Harbour . . .
. . . das amerikanische Kriegstrauma schlechthin . . .
Kent Nagano: . . . ja, das sorgte für Boshaftigkeiten. Man muss sich das mal vorstellen: Meine Großeltern waren Endes des 19. Jahrhunderts aus Japan nach Kalifornien gekommen, um Morro Bay galten sie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts sozusagen als Alteingesessene, als Pioniere. Meine Eltern konnten kaum mehr japanisch sprechen und lebten amerikanischer als die Amerikaner. Und doch wurden sie nach Pearl Harbour in ein Internierungslager gesteckt, mein Vater wurde enteignet, sein Geschäft wurde ihm abgenommen, sein Landbesitz. Auch ich habe als Kind in den 50er Jahren vermutlich mehr Hotdogs und Hamburger gegessen als andere Kinder, aber auch ich sah eben japanisch aus.
Manchmal führen erst solche Erfahrungen zu einer übersteigerten Idealisierung und Identifizierung mit dem fremden Ursprungsland. Zumindest diskutieren wir das in unseren Integrationsdebatten.
Kent Nagano: Das kann ich von mir nicht behaupten, schon allein wegen der Sprachbarriere fühlte und fühle ich mich nicht in besonderer Weise verbunden mit der modernen japanischen Gesellschaft. Als wir mit dem Münchner Staatsorchester in Japan konzertierten, irritierte und amüsierte ich die Leute dort mit meiner Ausdrucksweise. Ich sprach das Japanisch meiner Großeltern, ein Japanisch von 1890.
Ihre Frau ist doch Japanerin.
Kent Nagano: Wir sprechen zu Hause aber nur Englisch, Französisch, ab und zu Deutsch. Wir erörtern auch nicht die Befindlichkeit der japanischen Gesellschaft. Eine Tragödie wie in Fukushima bildet da selbstverständlich eine Ausnahme, aber da hat ja die ganze Welt Anteil genommen.
Waren Sie überrascht davon, wie überrascht die westliche Welt davon war, wie offensichtlich die Japaner gelitten haben?
Kent Nagano: Für wen war das überraschend?
Selbst europäische Intellektuelle arbeiteten sich an ihrem Bild von einer typischen japanischen Mentalität ab. Der japanische Philosoph Kenichi Mishima zum Beispiel kritisierte in einem Interview vehement das Klischee vom stets beherrschten, gut organisierten, sogar vom unterkühlten Japaner und also die ignorante Unkenntnis westlicher Gesellschaften, vor allem auch gebildeter Kreise.
Kent Nagano: Das Bild der meisten Europäer und Amerikaner ist doch geprägt von den strengen, wenn sie so wollen, konservativen Ritualen der japanischen Gesellschaft. Meine Frau stammt aus einer konservativen japanischen Familie, in der gerade deshalb diese Rituale intensiv gepflegt wurden, weil die Familie fast nie in Japan gelebt hat. Natürlich ist es falsch, davon auf individuelle Gefühle zu schließen oder sogar auf kollektive Gefühlswelten.
Herr Nagano, Sie gelten als Mensch, der ungern von seinem Innenleben berichtet. Dennoch abschließend die Frage: Nach einem öffentlichen Zerwürfnis mit dem Intendanten der Münchner Staatsoper beenden Sie zum Ende der Spielzeit 2012 / 13 Ihre siebenjährige Amtszeit als Generalmusikdirektor. Wie schwer hat Sie dieser künstlerische und politische Zwist verletzt?
Kent Nagano: Meine Familie und ich hatten und haben eine wundervolle Zeit in München. Wir fühlen uns in dieser Gesellschaft nicht nur respektiert, sondern von ihr aufgenommen. Bei all den Erfahrungen, über die wir in diesem Gespräch gesprochen haben, ist das doch etwas sehr Schönes.