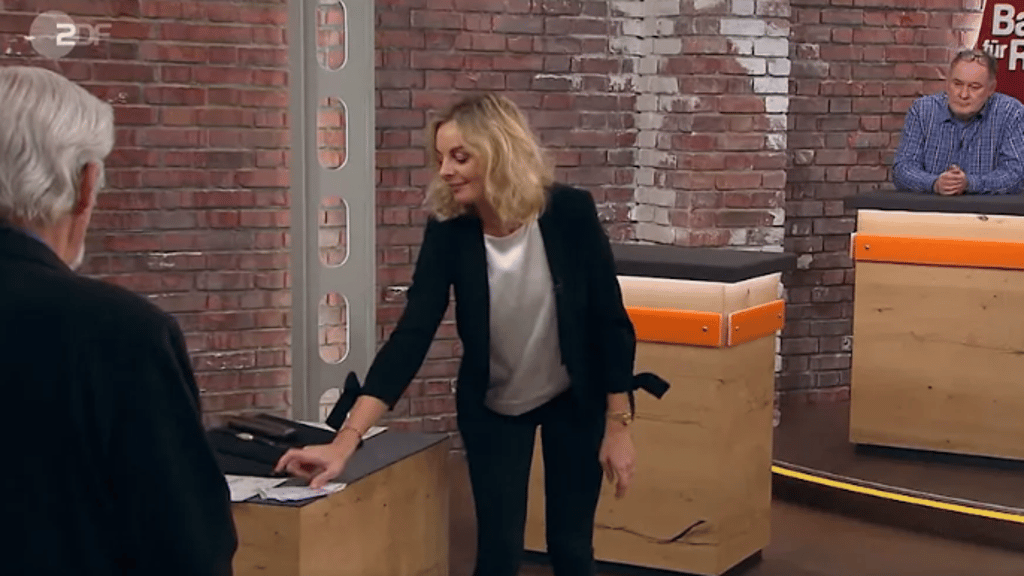«Die verschwiegene Bibliothek» «Die verschwiegene Bibliothek»: Rückkehr aus dem Vergessen
Leipzig/MZ. - Hundert Prozent
Joachim Walther, 1943 in Chemnitz geboren, ist selbst ein Mann, der DDR-Literaturgeschichte geschrieben hat. 1996 veröffentlichte der in Berlin-Grünheide lebende Autor ein Buch, das ihn auch einsam gemacht hat: "Sicherungsbereich Literatur" - die fundamentale Recherche über Stasi und Schriftstellerei in der DDR. Immer wieder waren Walther literarische Arbeiten in die Hand gefallen, die von der Stasi als Beweismittel kassiert worden waren. Da gab es den Fall des Berliner Autors Manfred Barz, der für 56 Seiten einer Komödie zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist. "Hundert Prozent" hieß das Stück des 1934 geborenen Autors über die sogenannten Volkswahlen. "Es hat keine Satire gegeben in der DDR", sagt Joachim Walther, "sondern nur Humoresken, die den gesellschaftlichen Konflikt nicht trafen." Der Barz-Text traf.
Geht alles gut, wird man diese Komödie bald lesen können. Ines Geipel und Joachim Walther starten im Frankfurter Verlag Edition Büchergilde "Die verschwiegene Bibliothek": Literatur, die in der DDR nicht erscheinen durfte. Auf zwanzig Bände ist die Reihe entworfen, die Namen wie Heidemarie Härtl, Siegmar Faust, Thomas Körner, Andreas Reimann und Gabriele Stötzer-Kachold führt. Pro Saison erscheinen zwei Bücher; die ersten beiden Bände werden heute auf der Buchmesse präsentiert: Edeltraud Eckert (1930-1955) "Jahr ohne Frühling" und Radjo Monk (Jahrgang 1960) "Blende 89". Wer gilt als "verschwiegener" Autor? Der Begriff sei viel zu milde, sagt Walther. Manche der bezeichneten Autoren wurden ja auch weggesperrt oder in den Tod getrieben. Landeten sie als Freigekaufte im Westen, wurden sie im Zuge der Annäherungs-Politik nicht selten als genauso störend begriffen wie im Osten. Als "verschwiegen" gelten Texte, die in der DDR unterdrückt worden sind; wohlgemerkt literarische Texte, sagt Walther, nicht etwa "politische Frusttexte oder Pamphlete".
Tatsächlich besteht die Gefahr, dass die Lebenstragik eines Schriftstellers den Blick für die literarische Gültigkeit seiner Texte trüben kann. Man habe Autoren abgelehnt, sagt Walther, die nur ein hartes Schicksal vorzuweisen hatten. Dabei mag man ja zum Beispiel die Gedichte der Edeltraud Eckert für konventionell halten, sagt Walther, aber das Mädchen war 20, als es 1950 wegen des Besitzes von Flugblättern zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt worden ist. Sie habe nur aus dem schöpfen können, was sie bis dahin an Literatur kannte: Das waren die Klassiker und Rilke. Edeltraud Eckert starb 1955 an den Folgen eines Arbeitsunfalls, den sie in der Haft erlitten hat. Die Gedichte werden im Zusammenspiel mit dem von Ines Geipel verfassten Nachwort zu einem Ereignis: jeweils ein anrührendes Zeugnis - die Literatur und das Leben.
Dabei ist ja die Frage nach der DDR-Literaturgeschichte keine rhetorische; es gibt da heute kein Werk, das auf der Höhe der Zeit wäre. So werden Entdeckungen zu machen sein. Rund 40 000 Seiten Literatur wurden gefunden, Arbeiten von über 100 Autoren, die nun ein Archiv "Unterdrückte Literatur in der DDR" bilden, das im kommenden Monat in Berlin eröffnet wird.
Letzte Schubläden
Wurde die Arbeit von Kollegen unterstützt? Eher nicht, sagt Walther. Es gab jene, die sich auch vor 1989 für die Außenseiter engagierten: Adolf Endler zum Beispiel, Uwe Grüning und Bernd Jentzsch. Nun schlägt die Stunde der einst kriminalisierten und abgeschobenen Stimmen: ein Echolot Ost. Literatur, die niemand auf der Rechnung hatte, als von der Politik 1989 mit einigem Triumph verkündet wurde, dass die Schubläden der DDR-Autoren leer gewesen seien.
Büchergilde: Messe-Halle 4. Stand B 201