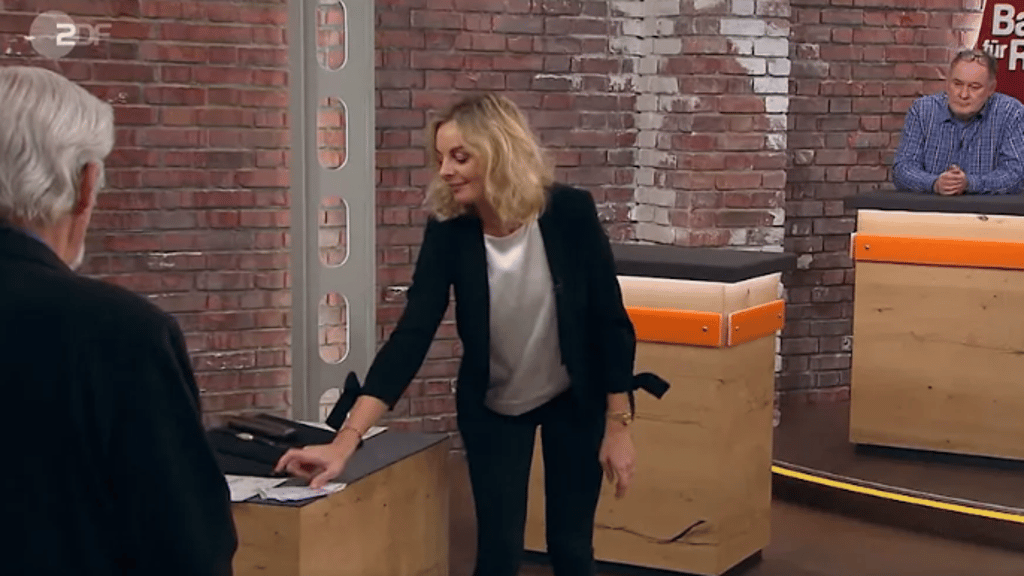Christa Wolf Christa Wolf: Ein Werk? Um Gottes willen!
Berlin/MZ. - Am Mittwochabend zog Christa Wolf von ihrem Wohnsitz in Berlin-Pankow her an den kiefernbeschatteten Südwestrand des alten Westberlin, um in der Gründerzeitvilla am Wannsee zu lesen und zu erklären, was ihr wichtig ist. Vorgestellt von dem Publizisten Jörg Magenau, der 2002 eine 500 Seiten starke Biografie der Autorin veröffentlicht hatte.
Ein solcher Auftritt sorgt immer für Interesse. Nicht allein deshalb, weil Christa Wolf in ihrer Wirkung die bedeutendste gesamtdeutsche Schriftstellerin der späten 70er und kompletten 80er Jahre gewesen ist und eine Wolf-Befragung deshalb immer auch Züge einer kollektiven Selbsterhellung aufweist. Sondern auch, weil die Autorin, die im März 77 Jahre alt geworden ist, eine Person ist, die zwar immer mal wieder im Schlaglicht der Öffentlichkeit steht, diese aber gar nicht sucht, ja geradezu vor jeder Art von Rummel zurückscheut.
Und Gerhard lacht
Unkontrollierte Statements liegen der Autorin nicht, die zuletzt im Frühjahr den Essayband "Mit anderem Blick" vorlegte; das freie Gespräch führt Christa Wolf gern in überschaubaren Kreisen. Erst dieser Tage lehnte sie eine Wortmeldung im Blick auf die Biermann-Ausbürgerung vor 30 Jahren ab, weil sie darüber selbst endlich "etwas Abschließendes" schreiben wolle. "Denn wenn andere das machen, bin ich nie zufrieden, nie."
Schwarzer Blazer, weiße Bluse, ein blumig gemusterter Damenschal: Es ist eine überaus aufgeräumte, ja im Umgang nahezu unbefangene Christa Wolf, die an diesem Abend zu erleben ist. Stets im Blickkontakt zu ihrem Mann, dem Schriftsteller und Verleger Gerhard Wolf, der von der zweiten Reihe aus, das Publikum mit gewitzten Zwischenrufen und Pointierungen unterhält.
Es sei wohl nicht davon auszugehen, eröffnet Jörg Magenau, dass Christa Wolf einen Werkbegriff pflege, der dem von Thomas Mann gleichzusetzen sei. Der notierte in seinem Journal Sätze der Preisklasse: "Vormittags zwei Stunden am Hauptwerk". Da fällt Christa Wolf ihrem Moderator ins Wort: "Sie kennen meine Tagebücher nicht!" Wäre ich aber sehr gespannt! "Da können Sie lange warten!", sagt die Wolf und lacht. Nein, ihr klinge der Begriff "Werk" viel zu monumental: "Wie ein Steinmal, das abgeschlossen ist". Sie spottet: "Du hast ein ,Werk' abgeliefert? Aha. Um Gottes willen!" So begreife sie ihre Arbeit nicht, die nach außen hin 1961 mit der noch völlig ideologiefrommen "Moskauer Novelle" begann. "Die meisten von ihnen werden sie hoffentlich nicht kennen, sie ist auch nicht mehr lieferbar."
Nicht aus den allbekannten Büchern liest Christa Wolf, sondern aus verstreut veröffentlichten Essays, die Wirkmotive ihrer Arbeit zeigen. Dass diese Texte hauptsächlich aus den 70er Jahren stammen, ist wohl kein Zufall. Aus "Lesen und Schreiben" stellt Christa Wolf den Abschnitt "Realitäten" des Titel-Essays vor, der 1968 für den Mitteldeutschen Verlag verfasst wurde, aber erst 1972 bei Aufbau erschien. Als sie das Buch aus dem Regal zog, sagt Christa Wolf, sei ihr eine Notiz der Cheflektorin des Mitteldeutschen Verlages entgegengeflattert: Der Essay vertrete weltanschaulich "schädliche" Ansichten, was "nicht zu reparieren" sei, eine Veröffentlichung vor dem 20. Gründungstag der DDR 1969 sei daher unbedingt zu verhindern. "So ist es auch gekommen."
In seinem Kern bricht der Aufsatz mit der damals noch gängigen Widerspiegelungstheorie nach Georg Lukács. "Literatur und Wirklichkeit stehen sich nicht gegenüber wie Spiegel und das, was gespiegelt wird. Sie sind ineinander verschmolzen im Bewusstsein des Autors." Dann setzt es den Satz: "Der Autor nämlich ist ein wichtiger Mensch." Eine polemisch gesetzte Formel in diesem Fall, die - aus ihrem Zusammenhang gelöst - einigen kunstreligiösen Klang entfalten kann. Sie habe versucht, sagt Christa Wolf, damit das Feld für ihr "Christa T."-Buch zu bestellen: "Schlau, wie wir erst anfingen zu werden". Egal aus welchem Essay sie liest - "Über Sinn und Unsinn von Naivität" (1973) oder aus dem Günderrode-Aufsatz von 1979 -, das Einzelwerk wird als ein "abgelegtes Werkzeug" (Bazon Brock) kenntlich. Ein Instrument, um ein neues Werk herzustellen: "Kindheitsmuster" im ersten, "Kein Ort. Nirgends", "Sommerstück" und "Was bleibt" im zweiten Fall.
Keine Hoffnung mehr
Letztere bereits Arbeiten der politischen Resignation. Seit dem SED-"Kahlschlag"-Plenum von 1965, sagt Christa Wolf, habe sie keinerlei Hoffnung mehr gehabt, "dass sich eine humane und lebbare Gessellschaft" in der DDR verwirklichen ließe. Das erstaunt dann doch. Was hatte sie denn noch erwartet? Christa Wolf kehrt die Frage um: "Was hätte ich woanders erwartet? Ich hatte keine Alternative. Genau das meint der Buchtitel ,Kein Ort. Nirgends'." Auch nicht im Westen.
Was Christa Wolf in der Wannsee-Behaglichkeit vorträgt, offenbart ein zutiefst protestantisches Ethos: Immer wieder die Pflicht, gegenüber sich selbst und den Anderen Zeugnis abzulegen, durch Erklärungen zu klären, sich gegenseitig zu stärken, die Schrift als ein Medium der Selbstvergewisserung zu nutzen. "Ich muss schreiben, um mir selbst kenntlich zu werden."
Man lauscht den in der Sache überbordenden Essays ab, wie deren Gegenstände seinerzeit nicht nur das Genre, sondern die Autorin selbst überfordern mussten. Alles lief allein auf diese Person zu - aus einer radikalen Abwesenheit von Öffentlichkeit und tatsächlicher Politik. Bei aller Resignation, die abzuwehren ihr schwer falle, sagt Christa Wolf, "bleibt die Pflicht, weiter zu schreiben". Auch wenn ihr das Schreiben heute als "so extrem schwierig" erscheine wie nie zuvor. "Andererseits: Was soll ich machen?" Wolfs Werk ist die Werkbank der Selbstbehauptung.