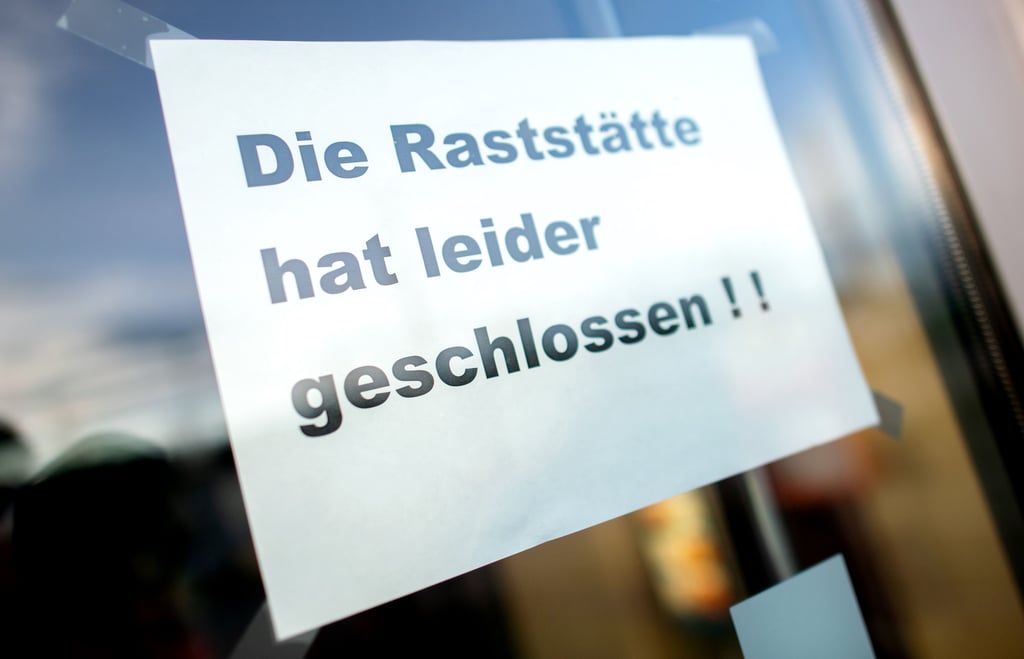"Schulen wollen Schema F" Lysann Heyde fördert Hochbegabte in Leuna.

Leuna - In gewisser Weise ist das Kultusministerium schuld daran, dass Lysann Heyde heute in einer - großzügig mit Sofas und Sesseln ausgestatteten - Praxis in der Leunaer Villa Arbor sitzt. Denn die Diplomsozialpädagogin wollte nach ihrem Studium sich zwar mit Hochbegabten beschäftigen, allerdings nur als Forschungsthema und nicht praktisch.
Hochbegabte passen nicht ins normale System
Doch irgendwann, so erzählt die 37-Jährige, habe das Ministerium angerufen, sie hätten eine Familie, die sie gern vorbeischicken wollten. Es folgten weitere Familie, deren Kinder zwar über hohe Intelligenz verfügten, aber im normalen System nicht zurechtkamen. Sie habe im Laufe der Jahre Strategien entwickelt, wie sie diese Kinder unterstützen kann, sagt Heyde. Sie machte sich schließlich im vergangenen Sommer mit ihrer Praxis für Leistungsdiagnostik selbstständig.
Dorthin kämen zwar auch mal Erwachsene, die sich beruflich umorientieren wollen, berichtet die gebürtige Brandenburgerin. Doch das Gros ihrer Klienten seien Kinder und Jugendliche – und deren Familien. „Einige haben schlimme Schulkarrieren hinter sich mit zahlreichen Schulwechseln, passiver und aktiver Abwesenheit“, berichtet die Sozialpädagogin.
Nicht allein am hohen IQ festzumachen
Denn intellektuelle Hochbegabung, die für Heyde nicht allein am IQ festzumachen ist, sondern sich auch in der Fähigkeit ausdrückt, Wissen auf neue Situationen zu übertragen, ist kein Garant für schulischen Erfolg. Hört man der Expertin zu, scheint häufig eher das Gegenteil einzutreten, hochbegabtes Kind und Schulsystem scheinen nicht zusammenzupassen. Das liegt aus Heydes Sicht etwa an den komplexen kreativen Denkmöglichkeiten der Betroffenen. „Viele Schulen wollen immer noch Schema F. Viele der Kinder verstehen dann nicht, warum sie beispielsweise den Lösungsweg aufschreiben sollen, wenn sie das Ergebnis schon im Kopf haben.“
Auch würden sie bei den sich wiederholende Aufgaben schnell abschalten. Nach Jahren mit solchen Erfahrungen würden sie den Fehler dann bei sich suchen. Heydes Aufgabe ist es ihnen aus dieser Situation herauszuhelfen. „Es geht dabei nicht darum, am Ende ein leistungsstarkes Kind zu haben, sondern zu klären, was der richtige Weg für das Kind ist.“ Da könne es etwa sein, dass ein Kind mit einem IQ von über 130, auf die Realschule wechselt.
Hochbegabte verstehen: Zusammenarbeit mit Schulen
Um diesen Weg zu finden, beginnt Heyde zunächst mit einer umfassendes Diagnostik. Dabei geht es nicht nur, um Intelligenztest und Persönlichkeitsfaktoren beim Kind, sondern auch um die Familie. Wie ist das Kind dort eingebettet? Bekommt es zu viel oder zu wenig Aufmerksamkeit. Die Sachverständige geht zudem in die Schulen zum Hospitieren. „Damit ich das Kind auch in seinem Lebensumfeld Schule sehe.“
Denn Heyde führt eine Reihe von Faktoren auf, die beeinflussen, ob das Kind seine Hochbegabung auch ausleben kann. Seelische Gesundheit und Selbstbewusstsein zählen dazu. Auch die soziale Position im Freundeskreis sei für Kinder und Jugendliche wichtig. Probleme dort könnten sich auch auf die schulischen Leistungen übertragen, erklärt Heyde. Deswegen könne es bisweilen geboten sein, bei den sozialen Faktoren anzusetzen.
Mitwirkung der Familie essentiell
Auf jeden Fall immer mitarbeiten müssten die Familien der Kinder, sagt die Hochbegabtenberaterin: „Ich bin keine Praxis, wo die Kinder abgegeben werden und dann ’fertig’ wieder abgeholt werden können.“ Die Aufgaben der Eltern könne etwa darin bestehen, sich stärker zurückzunehmen, nicht zu viel für das Kind zu bestimmten, denn: „Hochbegabte können auf einem Intelligenzniveau über sich reflektieren, das eigentlich unglaublich ist.“
Heydes Reflexion über ihren Schritt in die Selbstständigkeit fällt derweil positiv aus. An Kundschaft mangelt es ihr bisher nicht. Weil es wenige vergleichbare Angebote gebe, kämen die Familien, die Diagnostik und Beratung mit ihr meist aus eigener Tasche zahlen müssten, teilweise sogar aus Thüringen und dem Berliner Raum. Und die enormen Strecken müssen die nicht nur einmal auf sich nehmen, wie Heyde erklärt: „Eine Familie muss mit ein, zwei Jahren rechnen, bis man bei einem Status ist, ab dem nur noch Kontrolltermine jedes halbe Jahr notwendig sind.“
(mz)