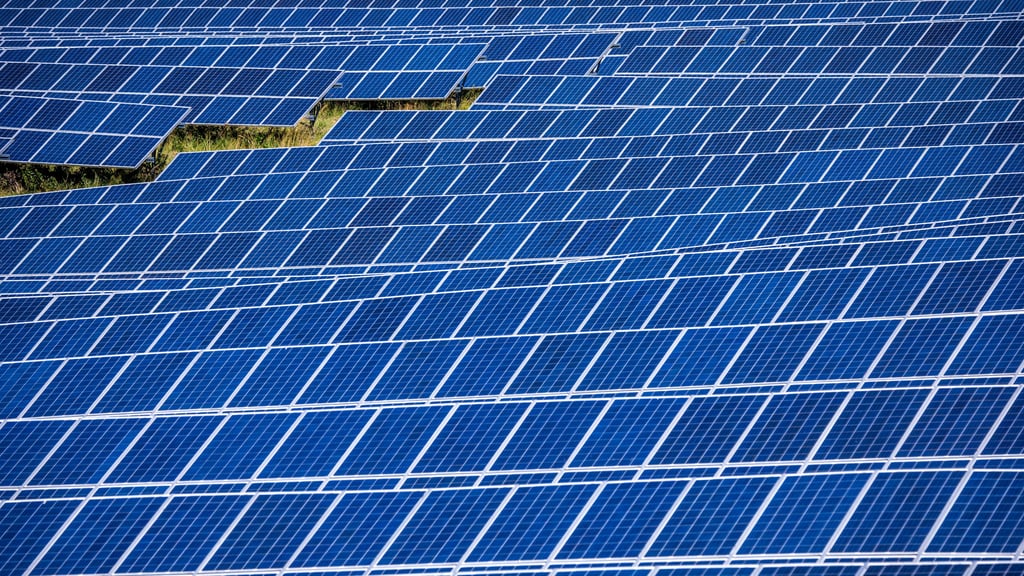Kreisjägermeister Kreisjägermeister: Der Rekord-Waidmann aus Schmon

Schmon - Die Trophäen hängen im Jagdzimmer im Keller – und ließe man Harald Schwarz, er könnte hier stundenlang erzählen. „Jede hat ihre eigene Geschichte“, sagt der 68-Jährige. Da wäre zum Beispiel der ungerade 26-Ender, den sein Vater 1982 im Wald gefunden hat. Oder der „Wendehirsch“, erlegt am Tag der Deutschen Einheit, dessen Geweih beim Putzen schon einmal heruntergefallen ist.
Harald Schwarz ist seit 1977 Jäger - aber nicht nur das. Seit 25 Jahren ist er auch ehrenamtlicher Kreisjägermeister, der dienstälteste in Sachsen-Anhalt.
Gesunder Wildbestand ist Ziel
Seine Leidenschaft kommt nicht von ungefähr: Schon als Kind hat der in Schmon aufgewachsene Schwarz mit seinem Vater, ebenfalls Jäger, auf dem Ansitz gesessen, hat ihm als Zwölfjähriger beim Versorgen des Wildes geholfen. Vor allem, sagt er, sei es die „Zweisamkeit mit der Natur“, die ihn fasziniere. „Es gibt so viel zu sehen – und wenn es die Spinne ist, die sich vor Ihnen abseilt.“ Oder die Stimmung in der Natur, die sich mit dem Lichteinfall verändert. Einmal die Woche, mitunter auch öfter, geht Schwarz selbst auf Jagd - den Vorwurf von Schießwut will er sich dabei allerdings nicht machen lassen. „Wir sitzen so oft draußen und strecken nichts. Dieses Jahr hatte ich noch nicht einen Rehbock, aber ich trauere dem nicht hinterher“, sagt er. Vielmehr gehe es darum, dass alle Tierarten gleichberechtigt existieren können, ein artenreicher, gesunder und verträglicher Wildbestand gehegt wird. Auch Schaffung und Pflege von Biotopen gehörten dazu.
Schwarz, ehemaliger Schulleiter, war schon vor der Wende Vorsitzender einer Jagdgesellschaft, 1991 wurde er Kreisjägermeister im Altkreis Querfurt. Nach der Kreisfusion übernahm er das Ehrenamt für den neuen Kreis, in dem es nach seinen Angaben rund 700 Jäger gibt. Unter anderem sitzt er damit dem Jagdbeirat vor, in dem auch Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft vertreten sind. „Der Landwirt hat oft einen ganz anderen Blick“, sagt der Mann, dem die immer großflächige Landwirtschaft ein Dorn im Auge ist. Inzwischen würden einige Blühstreifen und Grünäsungs-flächen geschaffen, „aber das ist noch nicht genug“. Das Niederwild sei extrem zurückgegangen. Unzufrieden ist Schwarz auch damit, dass alle bisherigen Maßnahmen gegen Wildunfälle „zwar für den Moment, aber nicht bleibend etwas gebracht haben“.
In den vergangenen 25 Jahren hat sich dennoch einiges getan. Moderne Technik ist auch bei den Jägern eingezogen. Vor zwei Jahren wurde in Zusammenarbeit mit dem Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut einem Rothirsch ein Sender verpasst – jede Woche erhält Schwarz seitdem Daten, wo das auf den Namen „Helmut“ getaufte Tier sich herumtreibt. Forscher wollen so herausfinden, wie sich der Eingriff des Menschen in die Natur auf die Entwicklung des Wildes auswirkt. Überhaupt, Stichwort Forschung: Seit Jahren ist Schwarz selbst Mitglied der Gesellschaft für Jagd- und Wildtierforschung. „Begründete wissenschaftliche Argumentation kommt bei den Menschen an.“
Suche nach Nachwuchs
Natürlich hat es auch Konflikte gegeben. Die Reibungsflächen zwischen den Jägern etwa hätten zugenommen, sagt Schwarz. „Ich habe immer versucht, zu einem Konsens zu kommen.“ Und auch wenn er sagt, er wolle „kein Johannes Heesters der Jagd werden“: Solange es die Gesundheit zulasse und er akzeptiert werde, wolle er das Ehrenamt des Kreisjägermeisters auch ausüben. Herausforderungen schließlich gibt es noch genug.
Die Nachwuchssuche ist eine davon – aktuell liege der Altersdurchschnitt bei den Jägern bei rund 60 Jahren. Augenmerk müsse künftig zudem auf das Thema Wildtierkrankheiten gelegt werden. Um sie schnell zu erkennen, schicken Jäger Proben an Veterinärämter. Die afrikanische Schweinepest bei Schwarzwild, sagt Schwarz, sei schon bis Ostpolen vorgedrungen. Finde sie den Weg zum Nutzvieh, sei der wirtschaftliche Schaden „nicht auszudenken“. (mz)