Roman „Maifliegenzeit“ erschienen „Eine unfassbar schöne Gegend“: Matthias Jügler über sein neues Buch und Angeln an der Unstrut
Der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler führt mit seinem neuen Roman „Maifliegenzeit“ in das Unstruttal. Ein Gespräch über das Angeln, ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte und ein zweites Zuhause.

Naumburg/Nebra - Der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler führt mit seinem neuen Roman „Maifliegenzeit“ in das Unstruttal zwischen Memleben und Naumburg. Darin erzählt er über ein reales Schicksal und ein kaum bekanntes Kapitel der DDR-Geschichte: den vorgetäuschten Säuglingstod. Das Gespräch führte Redakteurin Constanze Matthes.
Wer das Unstruttal kennt und Ihren neuen Roman liest, entdeckt bekannte Orte. Wie sind Sie auf das Unstruttal als Kulisse gekommen?
Matthias Jügler: Mit meinem Onkel war ich früher sehr oft an der Unstrut angeln, nachts ging es auf Aal, am Tag auf Karpfen. Je mehr ich über das eigene Schreiben nachdenke, suche ich die Orte meiner Vergangenheit auf. Das Unstruttal war in meiner Jugend fast wie ein Zuhause. Deshalb stellte sich mir die Frage nicht, ob ich es als Handlungsort verwende. Es fühlte sich vielmehr wie eine ganz natürliche Entscheidung an. Es ist eine unfassbar schöne Gegend. Das Buch wird auch ins Englische übersetzt, was mich unheimlich freut.
Im Roman geht es um vorgetäuschten Säuglingstod in der DDR. In den Nachbemerkungen verweisen Sie auf den Fall der Karin S. Wie sind Sie auf den Fall gestoßen?
Zuerst dachte ich, dass ich zum Thema Zwangsadoption recherchiere. Ich habe dann jedoch bald bemerkt, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Ich habe mich bei Andreas Laake, dem Gründer der „Interessengemeinschaft (IG) Verlorene Kinder in der DDR“, gemeldet. Ich wollte mit einigen Müttern sprechen. Nachdem ich mit fünf bis sechs Frauen gesprochen hatte, bemerkte ich, dass die Geschichte von Karin S. die herzzerreißendste war. Als wir miteinander gesprochen haben, waren sie und auch ich zu Tränen gerührt. Mir war klar, dass ich ihre Geschichte erzählen muss. Es gab in der DDR Zwangsadoptionen, das Thema kennen die allermeisten. Aber was es auch gab: Dass Kinder für tot erklärt wurden, um sie anderen Eltern zu geben. Ich dachte, ich kenne alles über die DDR. Doch das war neu für mich. In Gesprächen mit anderen bemerkte ich dann, davon weiß eigentlich niemand etwas. Daraus einen Roman zu machen und damit beizutragen, dafür das Bewusstsein zu schärfen, auch in den alten Bundesländern, das war für mich besonders spannend.
Sie haben sich für eine männliche Hauptfigur entschieden. Was war der Anlass, es nicht aus der Perspektive der Mutter, sondern aus der des Vaters zu erzählen?
Ja, das wäre wohl naheliegend gewesen. Ein Jahr lang habe ich es auch versucht und ein Manuskript geschrieben, das schon etwa 100 Seiten hatte, bis ich bemerkte, dass da etwas nicht stimmte. Dann habe ich neu angefangen und kam auf die männliche Perspektive – und das Angeln, die Fische, die Natur, die eine wichtige Rolle spielt. Das war wie, als ob ich der einzige Fußballspieler in einer Mannschaft wäre und eine Art Bande hätte, um mir selbst einen Pass zuspielen zu können. Ich war froh und wusste, dass eben auch Väter suchen können und nicht nur Mütter. Was für mich noch interessant war, dass es sich um einen 65-jährigen Ich-Erzähler handelt und ich mich in jemanden hineinversetze, der mein Vater hätte sein können.
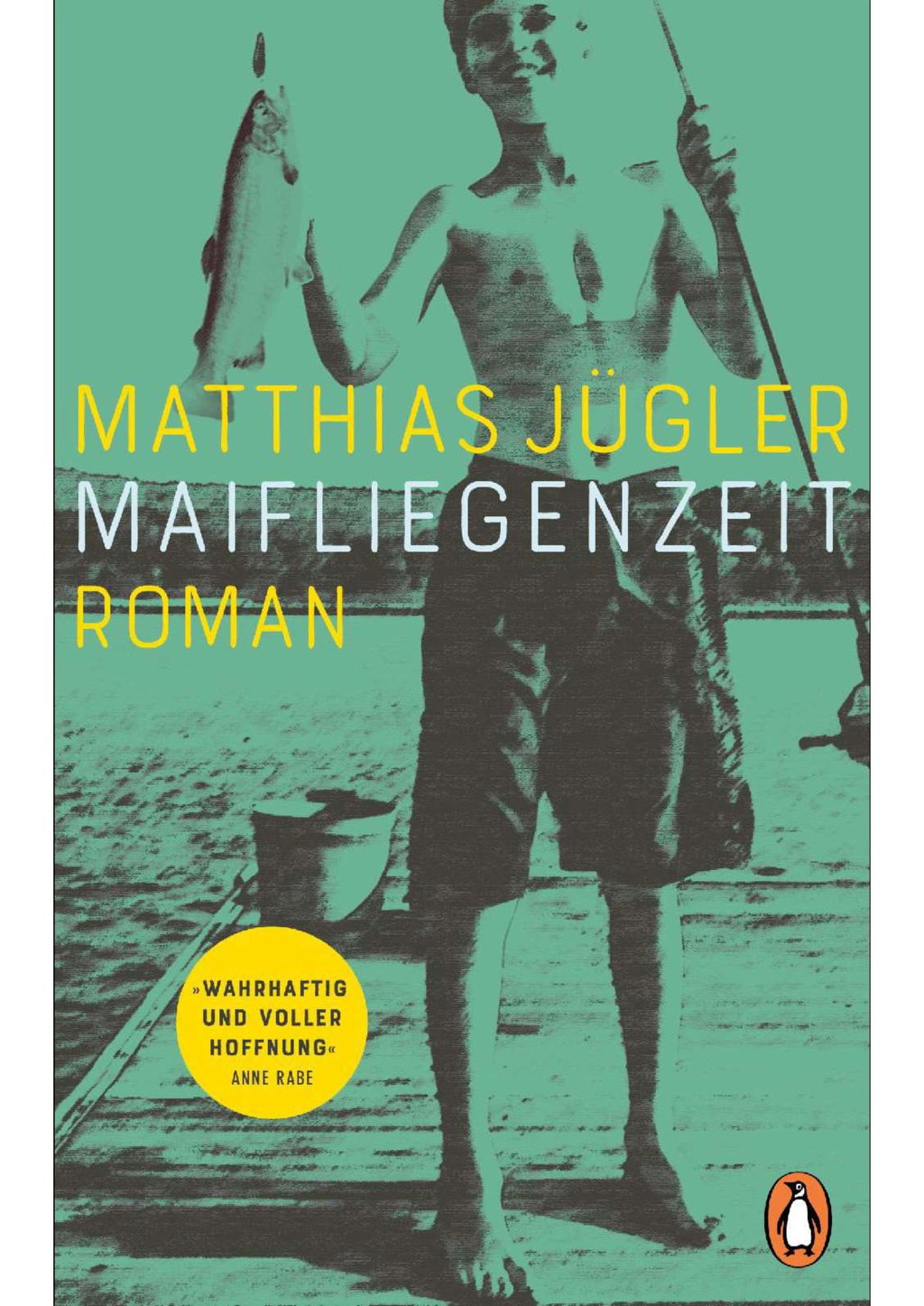
Es geht um das Angeln und Fische. Wie sind Sie selbst einst zum Angeln gekommen?
In meiner Familie wird erzählt, dass ich mit meinen Großeltern in Mecklenburg war. Ich war damals drei Jahre alt. Wir waren den ganzen Tag angeln und ich hatte einen Sonnenstich. Abends, als ich im Bett lag, war das Einzige, was ich sagen konnte: „Können wir morgen wieder angeln gehen?“. Ich bin im Kinderzimmer und am Fluss aufgewachsen. Die Saale wurde mein zweites Wohnzimmer, später auch die Unstrut, wo ich mit meinem Onkel viel angeln ging. Ganz oft bin ich mit meinen Großeltern nach Schweden zum Angeln gereist. Ich habe oft das Gefühl, dass das Angeln wie bei meinem Ich-Erzähler mich tröstet, obwohl ich selbst keinen Trost in jenem Moment nötig habe. Aber es macht trotzdem etwas mit mir, wenn ich am Fluss sitze und warte, dass ein Fisch anbeißt. Ich kann auch nicht sagen, dass Tage, in denen ich nichts fange, verlorene Tage sind.
Sie schreiben über ein dunkles Kapitel der DDR-Zeit wie bereits in ihrem früheren Roman „Die Verlassenen“. Zuletzt gab es Diskussionen zu Büchern junger Autoren, wie beispielsweise Charlotte Gneuß und ihren Roman „Gittersee“. Welche Reaktionen haben Sie erhalten?
Das war damals bei mir recht ähnlich wie bei Charlotte Gneuß. Ich habe E-Mails von Leuten bekommen, die älter als 60 oder 70 waren, und die mir schrieben, ich solle doch bitte aufhören, über die DDR zu schreiben, und ich soll die DDR, in der doch alles so schön und toll war, nicht kaputtmachen. Ich sei viel zu jung, um darüber zu schreiben. Ich solle mehr nach vorn schauen als zurück. Aber ich habe von Autorinnen und Autoren aus dem Umfeld sehr viel Bestärkung erfahren. Ganz im Sinne von: Gut, dass noch jemand darüber schreibt, weil es eben noch nicht vorbei ist und eben alle tangiert. Es gibt noch immer massive Unterschiede zwischen Ost und West, und diese kommen ja irgendwo auch her. Ich habe auch das Gefühl, dass es mir ein Bedürfnis ist, über jene Leute zu erzählen. Man muss die Geschichten einfach kennen, damit man auch die Gegenwart besser versteht.
Sie schreiben vom schmerzlichen Verlust eines Elternpaares. Sie sind selbst Vater. Was hat es mit Ihnen gemacht, darüber zu schreiben?
Vielleicht hat es mich ein bisschen gleichmütiger gemacht. Ich bin Vater von drei kleinen Kindern. Im Prinzip hat es meinen Blick geweitet. Die Interessengemeinschaft geht davon aus, dass es 2.000 Mütter und Väter gibt, die noch heute ihre Kinder suchen. Ich habe sehr viel Empathie für diese Menschen. Ich kann allerdings nicht sagen, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, auf diese Weise das Kind zu verlieren oder eben nicht zu verlieren, aber ich habe eine ungefähre Ahnung, dass es die Hölle ist. Mir war es auch ein Anliegen, dass ich nicht nur den Recherchestoff von Karin, die ihr Kind in Wippra zur Welt brachte, nutze, sondern weiter mit ihr in Verbindung bleiben will. Ich habe bis heute ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr.
Ihr fiktiver Roman beruht auf einem realen Hintergrund. Setzen Sie sich da Grenzen für das Schreiben?
Leben ist nicht gleich Literatur. Wenn ich nur aufschreibe, was ihr widerfahren ist, wird es redundant, gibt es Dinge, die nicht so wichtig sind, und es ist nicht so angeordnet, dass es den besten Effekt beim Lesen hat. Ich musste genau überlegen, was muss ich hinzufügen und was erzähle ich nicht, weil es nicht wichtig ist. Ich habe schon das Gefühl, dass ich den Stoff so verformen kann, wie ich es möchte. Ich modelliere es so, wie jemand, der mit Ton arbeitet. Doch mir ist es wichtig, auch von mir etwas hineinzubringen.
Sie beschreiben die Flusslandschaft auch als Rückzugs- und Kraftort. Haben Sie eine Lieblingsstelle an der Unstrut?
Ja, ich hatte einen solchen Lieblingsplatz, aber ich finde ihn nicht mehr. Es gibt einen Ort, da war ich mit meinem Onkel regelmäßig. Es war ein wunderschöner Ort, und wir haben dort gut Fische fangen können. Aber ich kann meinen Onkel nicht mehr fragen. Ich bin in den letzten Monaten zweimal an der Unstrut gewesen. Ich glaube, der Ort war bei Burgscheidungen.
Wie ist Ihr Schreiballtag als Autor?
Da gibt es verschiedene Phasen. Das ist nun mein drittes Buch. Ich bin nun in der Phase, dass ich nicht viel schreibe, weil derzeit viele Lesungen und Interviews anstehen. Aber im Kopf rattert es. Ich habe ein neues Thema, neuen Stoff, ich bin am Überlegen. Monatelang pflege ich allerdings meinen Brotjob, das freie Lektorieren. Aber ich weiß schon, dass ich in einem halben Jahr das Lektorieren hintenan stelle und dann wieder schreibe. Das Schreiben ist kein Prozess, wie: Ich gehe jetzt auf Arbeit und liefere ab. Mein Alltag läuft eher so: Die Kinder kommen früh in den Kindergarten, ich schreibe von 8 bis 13 Uhr, dann werden Haushaltssachen gemacht und die Kinder wieder abgeholt. Die reine Schreibzeit ist also eher rar. Dann heißt es auch Handy aus.
Sie sind bei einem großen Verlag. Was raten Sie jungen Autoren, die schreiben wollen, auf was müssen sie sich vorbereiten?
Sie sollten sich vorbereiten, dass es immer wieder Rückschläge und das Gefühl, man kann es einfach nicht, gibt. Als ich damals in Oslo studierte, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, einen Roman zu schreiben und ihn zu veröffentlichen. Das war 2008, mein erster Roman kam erst sieben Jahre später heraus. Es braucht Durchhaltevermögen. Zu Beginn dachte ich auch, ich gehe mit meinem Text zu einem Verlag. Doch so geht es einfach nicht. Wenn man einen Text hat, sollte man eine Literaturagentur suchen. Als mein erster Roman „Raubfischen“ herauskam, war ich megahappy. Dann habe ich „Die Verlassenen“ geschrieben. Meine Agentur suchte ein halbes Jahr nach einem Verlag, bis fünf Verlage ihr Interesse meldeten. Ich habe mich für den interessantesten entschieden. Selbst wenn man einen Verlag hat, aber nicht zu den 20 Bestsellerautoren zählt, wird man allein davon nicht leben können. Es braucht einen Job und ein gesichertes Einkommen.




