Bloß nicht die Balance verlieren Wie man Schwindel erkennt und behandelt - Arzt der Uni-Klinik Halle über die tückische Krankheit
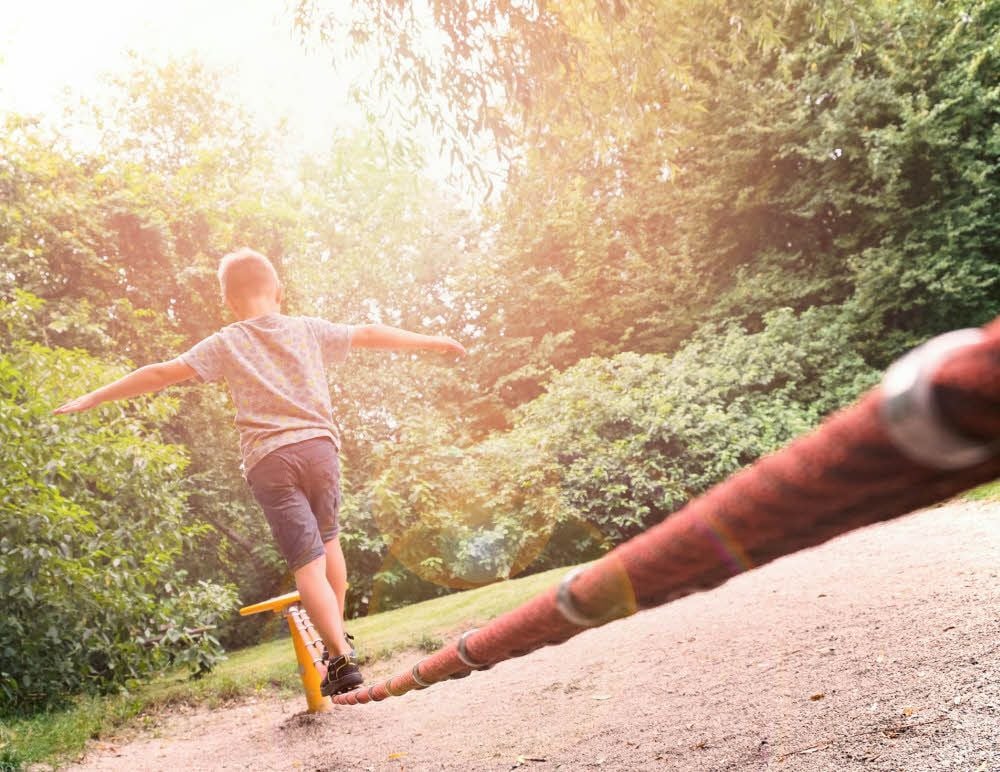
Halle (Saale) - „Eigentlich“, so betont Professor Dr. Stefan Plontke, „versuche ich, das Wort Schwindel zu vermeiden.“ Es sage nämlich recht wenig über die Krankheiten aus, die sich mit diesem Symptom bemerkbar machten. „Fragen Sie 100 Menschen, was sie unter Schwindel verstehen und sie erhalten 100 verschiedene Antworten“, fügt der Direktor der halleschen Universitätsklinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie hinzu.
Manchen werde schwarz vor Augen, andere seien benommen. Bei wieder anderen drehe sich alles oder sie fühlten sich, als ob ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen werde. Es sind erst diese Beschreibungen, die die Mediziner auf die Spur zur richtigen Diagnose bringen. „Man muss den Patienten gut zuhören“, unterstreicht der Arzt.
Professor Dr. Stefan Plontke: „Schwindel ist eine gestörte Orientierung des Körpers im Raum“
„Schwindel ist eine gestörte Orientierung des Körpers im Raum“, erklärt Stefan Plontke. Diese Orientierung werde durch verschiedene Informationen sichergestellt, die unserem Großrechner - sprich: dem Gehirn - aus verschiedenen Körperregionen zur Verfügung gestellt werden. Das eigentliche Gleichgewichtsorgan im Innenohr berichtet ihm über Lage und Bewegung des Kopfes, die Augen fixieren den Horizont, Rezeptoren in den Gelenken und Muskeln melden, ob wir etwas auf einer schiefen Ebene stehen und ein Bein mehr als das andere belastet ist. Rezeptoren auf der Haut registrieren Temperaturen, Berührungen oder Schmerz.
Die Nachrichten, die das Gehirn erreichen, sind gut aufeinander abgestimmt. Fallen jedoch einige davon aus, passt nichts mehr zusammen. Es gibt im Gehirn ein großes Durcheinander, was der Mensch dann als Schwindel registriert. „Auch wenn der Großrechner zu langsam wird, so wie ein alter Computer, tritt häufig ein Symptom wie Schwindel auf“, sagt Stefan Plontke. Dann würden die gelieferten Informationen nicht mehr schnell genug verarbeitet.
Dass es zu einem solchen Zustand kommt, kann viele Ursachen haben. Erster Ansprechpartner sei in diesem Fall der Hausarzt, betont der Spezialist. Der lotse den Patienten dann an die richtige Stelle. Nicht wenige erhielten eine Überweisung zum HNO-Arzt. Denn Schwindelerkrankungen, die mit dem Ohr zusammenhängen, seien sehr häufig.
Lagerungsschwindel zählt zu den dramatischsten Erkrankungen
„Eine der dramatischsten Erkrankungen ist der gutartige Lagerungsschwindel“, sagt Plontke. Der werde, wie der Name schon sagt, ausgelöst, wenn der Betroffene seine Lage verändert. Es handle sich immer um einen Drehschwindel, der häufig mit Übelkeit verbunden sei aber nie länger als eine Minute anhalte. „An sich ist das ungefährlich. Eben gutartig. Doch wenn es jemanden im falschen Moment erwischt, kann es absolut gefährlich sein“, sagt Plontke.
Er denkt an Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind, Bauarbeiter, die auf einem Gerüst stehen, Wanderer, die sich im Gebirge auf einem schmalen Geißenpfad bewegen. Betroffene seien oft ein Leben lang von starker Unsicherheit geprägt. Was dazu führe, dass sie oft sehr ängstlich seien. „Schwindel und Angst sind leider eng miteinander verbunden.“
Allerdings - richtig erkannt, ist der gutartige Lagerungsschwindel auch gut zu behandeln. Ein erfahrener HNO-Arzt könne den Patienten durch spezielle Lagerungsmanöver wieder schwindelfrei machen. Und ihm darüber hinaus entsprechende Übungen für Zuhause mit auf den Weg geben. Auslöser sind kleine Steinchen - genauer gesagt: Kalziumkarbonatkristalle - im Gleichgewichtsorgan, also im Innenohr.
Sie sorgen dafür, dass die lineare Beschleunigung des Körpers im Raum erfasst wird. Lösen sie sich jedoch - bedingt durch Alterungsprozesse oder Unfälle - aus ihrer gallertartigen Membran, dann bewegen sie sich unkontrolliert im Gleichgewichtsorgan, reizen dort diejenigen Rezeptoren, die erspüren, in welche Richtung sich unser Kopf dreht. Diese Rezeptoren leiten dann Falschmeldungen an das Gehirn. Was ein Schwindelgefühl auslöst.
Schwindelattacken: Morbus Menière geht vom Innenohr aus
Eine weitere Erkrankung, die vom Innenohr ausgeht, heißt Morbus Menière. Der Name geht auf den französischen Arzt Prosper Menière zurück, der 1861 ihre Symptome beschrieb. „Kennzeichen der Krankheit sind Schwindelattacken, die zwischen 20 Minuten und zwölf Stunden andauern können“, erklärt Plontke.
Hinzu kämen Hörminderungen, Ohrgeräusche und starke Übelkeit. „Die Patienten sind meist mehrere Tage außer Gefecht gesetzt“, sagt der Arzt. Denn häufig fühlten sie sich nach den Attacken erschöpft. Ursache dieser Erkrankung ist, vereinfacht gesagt, eine vermehrte Flüssigkeitsansammlung in Innenohr und Gleichgewichtsorgan. Dadurch verändern sich die Druckverhältnisse.
Ganz andere Ursachen für diese Erkrankung hat übrigens einst ein prominenter Sachsen-Anhalter ausgemacht: Martin Luther. Überliefert ist, dass er seit 1527 unter schweren Schwindelanfällen mit linksseitigen Ohrgeräuschen litt. Für ihn war das die Strafe Satans. Es ist der „schwarze zoticht Geselle aus der Höllen“, der ihn „in seinem Reich auf Erden nicht wohl leiden mag“.
Stufentherapie bei der Behandlung von Schwindel
Damals, so sagt Stefan Plontke, habe die Medizin noch nichts vom Gleichgewichtsorgan im Ohr gewusst. Doch den beschriebenen Beschwerden zufolge litt Luther eindeutig unter Morbus Menière. Um eine ganz sichere Diagnose zu stellen, würde er den Reformator heut mit einem ganz speziellen MRT-Gerät untersuchen und die Diagnose eindeutig nachweisen.
Bei der Behandlung spricht Plontke von einer Stufentherapie. Da werde zuerst einmal die Lebensweise in den Blick genommen. Sollte eine Änderung da nicht helfen, reichen die Möglichkeiten der Mediziner vom Medikamenteneinsatz bis hin zu komplizierten Operationen. „Das letzte Mittel ist, dass wir im Einzelfall den Gleichgewichtsnerv durchtrennen oder eben auch das Gleichgewichtsorgan des kranken Ohres entfernen“, erläutert Plontke. Dass aus dieser Richtung keine Informationen mehr kommen, damit könne sich das Gehirn besser arrangieren als mit chaotischen Informationen. „Wobei“, so ergänzt er, „dieser Schritt gut überlegt werden muss.“ Erkranke nämlich auch das zweite Ohr, werde es für die Patienten kompliziert. Sie seien dann in der Dunkelheit und auf weichem Untergrund, etwa Waldboden, hilflos.
Eine weitere häufige Form des Schwindels ist der Altersschwindel. „Heutzutage wird er auch multimodaler Schwindel genannt“, sagt Stefan Plontke. „Das heißt, dass sich im Alter neben ganz normalen Verschleißerscheinungen auch Krankheiten der Ohren, Augen, Gelenke oder des Gehirns einstellen“, erläutert der Mediziner. Meist müssten dann noch mehrere Medikamente eingenommen werden, die alle miteinander interagierten und auf deren Beipackzetteln als Nebenwirkung Schwindel stehe.
Tipp bei Schwindel: In Bewegung bleiben
Wichtig sei es, der Ursache genau auf den Grund zu gehen. Ist der Kreislauf für die Beschwerden verantwortlich? Sind es die Ohren oder die Augen? Macht vielleicht die Halswirbelsäule Probleme? Gefragt sei eine gute Zusammenarbeit mehrerer Fachrichtungen.
Der Altersschwindel ist aber auch eine Erscheinung, der gut vorgebeugt werden kann - durch Bewegung und Sport. Es komme darauf an, komplexe Bewegungsabläufe zu trainieren, betont der Mediziner. Er empfiehlt beispielsweise Tai Chi oder auch Ballspiele. Dadurch könnten Störungen kompensiert werden. „Es ist bewiesen, dass Menschen, die ihr Leben lang in Bewegung bleiben, seltener stürzen. Und wenn sie stürzen, sind die Folgen weniger schwer“, unterstreicht der HNO-Spezialist. „Das Schlimmste für ältere Menschen ist es, zu rasten.“
Schwindel: Auch der Kreislauf kann Ursache sein
Nicht jeder Schwindel geht von einer Erkrankung im Innenohr aus. Stefan Plontke, Direktor der halleschen Universitäts-HNO-Klinik erklärt, dass Patienten, denen schwarz vor Augen wird, typischerweise eine Kreislauferkrankung haben. Der Schwindel ist dann auf eine Minderdurchblutung des Gehirns zurückzuführen.
Zudem verweist er auf Schwindel mit psychischen Ursachen, sogenannten phobischen Schwindel. Der trete etwa bei der Fahrt in einer übervollen Bahn auf. Dahinter stecke keine organische Erkrankung.
An der Universitätsklinik, wo Schwindel-Patienten sehr häufig als Notfälle eingeliefert werden, gelte es in erster Linie herauszufinden, ob es sich um eine akut-lebensbedrohliche Erkrankung wie zum Beispiel einen Schlaganfall handle, oder um eine Erkrankung des Innenohrs, bei der keine Gefahr in Verzug sei, sagt Plontke. Beides könne mit den gleichen Symptomen einhergehen.




