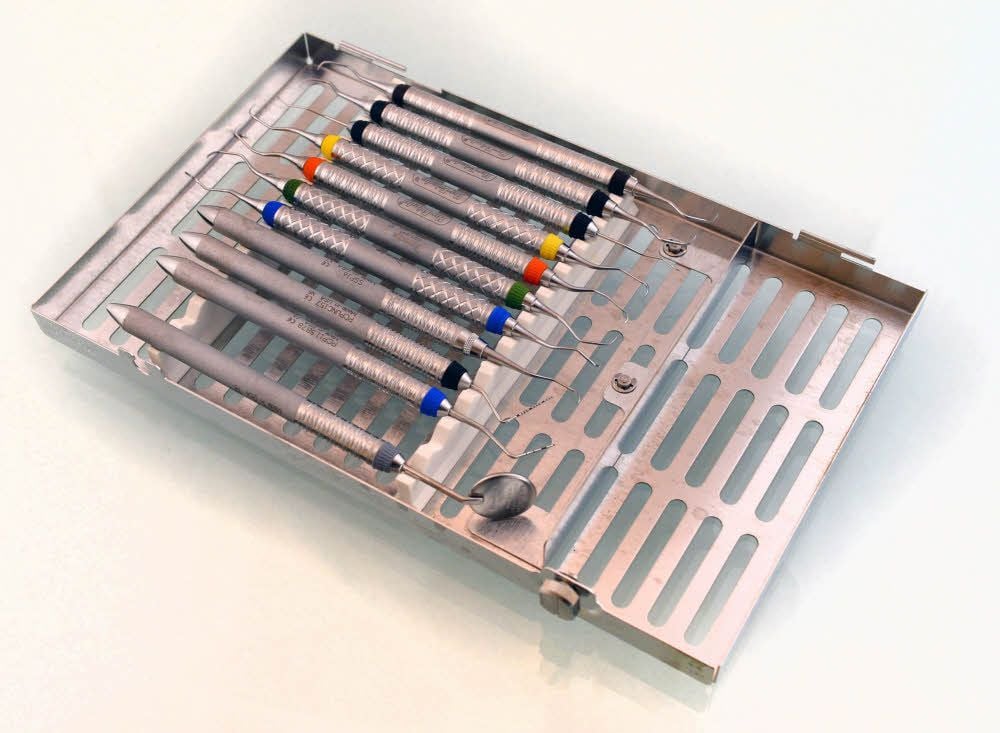Teil 36: Ein gutes Gebiss Teil 36: Ein gutes Gebiss: Wenn der Zahn nun ein Loch hat?

Halle (Saale) - Das Gebiss eines erwachsener Menschen besteht - wenn alle Weisheitszähne vorhanden sind - aus 32 Zähnen. Und jeder einzelne von ihnen hat beim Essen eine ganz spezielle Aufgabe zu erfüllen, wie der Dessauer Zahnarzt Dr. Jochen Schmidt erläutert: Die flachen Schneidezähne mit ihren scharfen Kanten sind ideal zum Abbeißen. Die Eckzähne, die relativ spitz sind, halten die Nahrung fest. Die folgenden kleinen Backenzähne, die zerkleinern sie weiter und vermischen sie mit Speichel. Und dann kommen die großen Backenzähne, die auch Mahlzähne genannt werden. Sie stellen durch ihre „Arbeit“ einen Speisebrei her, spalten die Nahrung schon in ihre Bestandteile auf. „Verdauung fängt bereits im Mund an“, sagt er.
Was aber, wenn einer dieser Zähne fehlt? „Dann fehlt auch etwas in dieser Zerkleinerungskaskade“, betont der Mediziner. „Und darauf reagieren Magen und Darm.“ Der Magen müsse dann praktisch das, was im Mund versäumt wurde, nachholen und die Nahrung aufspalten. Er bilde zu diesem Zwecke mehr Magensäure, die greife die Magenwände an und - wenn noch andere Faktoren wie Stress hinzukommen - könne das zur Bildung von Magengeschwüren führen. „Dem Darm geht es dann nicht viel besser“, fügt Schmidt hinzu. „Der bekommt statt feiner, kleiner Nahrung große Brocken. Die bleiben hängen und rufen Entzündungen hervor.“ Der Darm könne dann aus der Nahrung nicht das herausholen und dem Körper zuführen, was letzterer eigentlich braucht.
„Gesund beginnt im Mund“, bekräftigt Schmidt. Und deswegen seien er und seine Kollegen bestrebt, bei ihren Patienten die dort auftretenden Lücken zu füllen. Was übrigens auch für die noch vorhandenen Zähne gut ist. Sie müssen ansonsten die Arbeit der fehlenden miterledigen. Das führt mitunter dazu, dass sie sich ob der zusätzlichen Belastung lockern oder brüchig werden. Was aber kann nun alles getan werden?
Füllungen für Zähne
Wenn der Zahn aber nun ein Loch hat? Dann wird der Zahnarzt es in der Regel füllen. Das Mittel der Wahl ist bei den Backenzähnen meist Amalgam, eine Füllung aus Quecksilberlegierungen. Hauptsächliche Bestandteile sind neben dem Quecksilber Silber, Zinn und Kupfer.
„Amalgam ist ein plastisches Metall, das man gut in die Hohlräume reindrücken kann“, sagt Schmidt. Es dehne sich in den Löchern noch aus und dichte dadurch den Zahnrand so ab, dass Bakterien keine Chance mehr hätten, einzudringen. Amalgam härte schnell aus und sei dann sehr belastbar. Und da es zudem sehr kostengünstig ist, wird diese Behandlung von den gesetzlichen Krankenkassen auch voll bezahlt.
Trotz dieser vielen guten Eigenschaften - Amalgam ist wegen seines Anteils an Quecksilber in Verruf geraten. Zu Unrecht, wie Schmidt sagt. Das Quecksilber, das in den Mund gelange, sei chemisch gebunden und verliere dadurch seine Schädlichkeit. An der Oberfläche der Füllung bilde sich durch chemische Prozesse ein grauer Überzug aus Zinnoxid. Es werde also auch bei Kauen kein Quecksilber abgerieben. „Medizinisch ist nicht nachweisbar, dass Amalgam für den Körper schädlich ist“, unterstreicht der Zahnarzt. Und dennoch - bei nachgewiesener Unverträglichkeit und im seltenen Fall eines chronischen Nierenversagens sollte, so sagen Mediziner, auf seine Anwendung verzichtet werden. Unter diesen Umständen werden höhere Kosten auch von der Krankenkasse übernommen.
Wer generell auf Amalgam verzichten möchte, der kann auf Kunststoff- oder Keramikfüllungen zurückgreifen. Bei beiden ist jedoch das Material teurer und die Verarbeitung aufwendiger. „Zu den Preisen einer Amalgamfüllung ist das nicht zu machen“, betont Schmidt. Aber alles, was über deren Kosten hinausgeht, muss der Patient selber bezahlen. Bei Keramikfüllungen zum Beispiel, die außerhalb es Mundes in Handarbeit gefertigt werden, könne da schon mal ein Betrag von mehreren hundert Euro zusammenkommen. Übrigens - bisher war immer von den Backenzähnen die Rede. Bei den sichtbaren Schneidezähnen werden auch die Kosten für Kunststofffüllungen von den Krankenkassen übernommen.
Kronen auf schwächelnde Zähne
„Wenn die Zahnwände so dünn sind und die Gefahr besteht, dass sie beim Kauen wegbrechen, dann hilft auch eine Füllung nicht mehr, dann ist es besser, einen Deckel draufzusetzen“, erklärt Schmidt. Er spricht von einer Krone, die dem schwächelnden Zahn dann aufgesetzt wird. Ob eine solche Krönung allerdings stattfinden kann, das hänge von der Beschaffenheit der Wurzel ab. Die müsse, so betont der Mediziner, noch in Ordnung sein. Was er durch eine Röntgenaufnahme feststellen kann.
„Ist die Zahnkrone schon weg, der Nerv tot, die Wurzel aber noch vorhanden, dann besteht auch die Möglichkeit, in ihr einen Stift zu verankern und darauf eine Krone zu setzen“, ergänzt Schmidt. Allerdings sei das nicht in jedem Fall praktikabel.
Brücken als Lückenschluss
Ist auch mit der Wurzel nichts mehr anzufangen, dann kommt als Lückenschluss eine Brücke in Frage - vorausgesetzt es sind zwei „Pfeiler“ vorhanden. Von deren Beschaffenheit hängt dann das weitere Vorgehen des Zahnarztes ab. Er wird testen, ob sie mehr als die eigene Kaulast tragen können, ob sie schon Füllungen aufweisen, wie ihre Wurzeln beschaffen sind ... Kommt er zu dem Schluss, dass eine Brücke nicht trägt, dann könnte er in der Lücke eine künstliche Wurzel schaffen, sprich: zu einem Implantat greifen. „Das ist eine Titanlegierung, die in den Kieferknochen, wenn noch ausreichend vorhanden, geschraubt wird“, erläutert Schmidt. Darauf kann dann ein Zahn oder auch eine Brücke gesetzt werden.
Teilprothesen und Prothesen
Dass ein Zahnarzt alle Zähne ersetzen muss, das wird immer seltener. Nur noch jeder achte Senior in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen ist nach der jüngsten Mundgesundheitsstudie zahnlos. Und weil immer mehr Ältere eigene Zähne besitzen, kann der Zahnarzt festsitzenden Zahnersatz - übrigens eine sehr individuelle Angelegenheit - verankern.
„Es ist immer gut, eigene Zähne zu haben“, betont Schmidt, der den Vorsitz in der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt führt. „Deswegen fangen wir mit der Prophylaxe auch schon bei den Kindern in Kita und Schule an“, fügt er hinzu. Bei den Erwachsenen empfehle er häufiger eine Professionelle Zahnreinigung. Dass diese in der Gebührenordnung der Zahnärzte eine eigene Position erhalten habe, sei ein Hinweis, dass es sich nicht um eine sogenannte Igel-Leistung handle. Es sei vielmehr eine anerkannte prophylaktische Maßnahme. Er wünschte sich, die gesetzlichen Kassen würden mehr von den Kosten tragen.
„Wir Zahnärzte versuchen, die Patienten zu unterstützen, damit sie so lange wie möglich ihre eigenen Zähne behalten“, sagt er. „Denn das, was die Natur geschaffen hat, ist das Beste für den Menschen.“
Bonusheft spart Kosten
Was bezahlt die gesetzliche Krankenversicherung bei Zahnersatz?
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen zu Kronen, Brücken und Prothesen einen festgelegten Zuschuss. Dieser deckt einen Teil der Kosten für eine Standardversorgung. Was das heißt, das ist für jeden Zahn extra festgelegt. „Diese Standardversorgung ist durchaus ausreichend und zweckmäßig“, sagt Zahnarzt Dr. Jochen Schmidt. Zudem sei sie auch finanziell vertretbar. Allerdings, so räumt er ein, sei damit zwar gewährleistet, dass der Patient kauen kann. Das optische Maximum sei das aber nicht.
Wenn der Patient in den zurückliegenden fünf Jahren regelmäßig eine Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt wahrgenommen hat, die im Bonusheft dokumentiert ist, dann erhöht sich der Zuschuss um 20 Prozent. Nach zehn Jahren lückenloser Vorsorge sind es sogar 30 Prozent.
Schmidt appelliert vor diesem Hintergrund an die Patienten, rechtzeitig an den Zahnarztbesuch zu denken. Viele kämen erst im Dezember - und da könne nicht gewährleistet werden, dass jeder noch einen Termin zur Vorsorge bekommt. „Ich empfehle ohnehin, zweimal im Jahr den Zahnarzt aufzusuchen“, betont er. Dann könne so etwas nicht passieren.“
Wer finanziell nicht in der Lage ist, seinen Anteil zu tragen, kann unter eine Härtefallregelung fallen. Die Krankenkasse übernimmt dann die Kosten zu 100 Prozent - sofern es sich um die Standardversorgung handelt. Für 2016 gelten folgende Voraussetzungen: Das Bruttoeinkommen eines Alleinstehenden übersteigt 1 162 Euro nicht. Bei einem Angehörigen sind es 1 597,75 Euro. Für jeden weiteren Angehörigen kommen 290,50 Euro dazu.
Wer nur knapp über diesen Einkommensgrenzen liegt, der sollte sich mit seiner Kasse in Verbindung setzen. In der Regel kann sie sich über den Festzuschuss hinaus mit einem zusätzlichen Anteil an den Kosten beteiligen. (mz)