"Fit in den Herbst" - Teil 6 "Fit in den Herbst" - Teil 6: Diabetes - Der süße Fluch
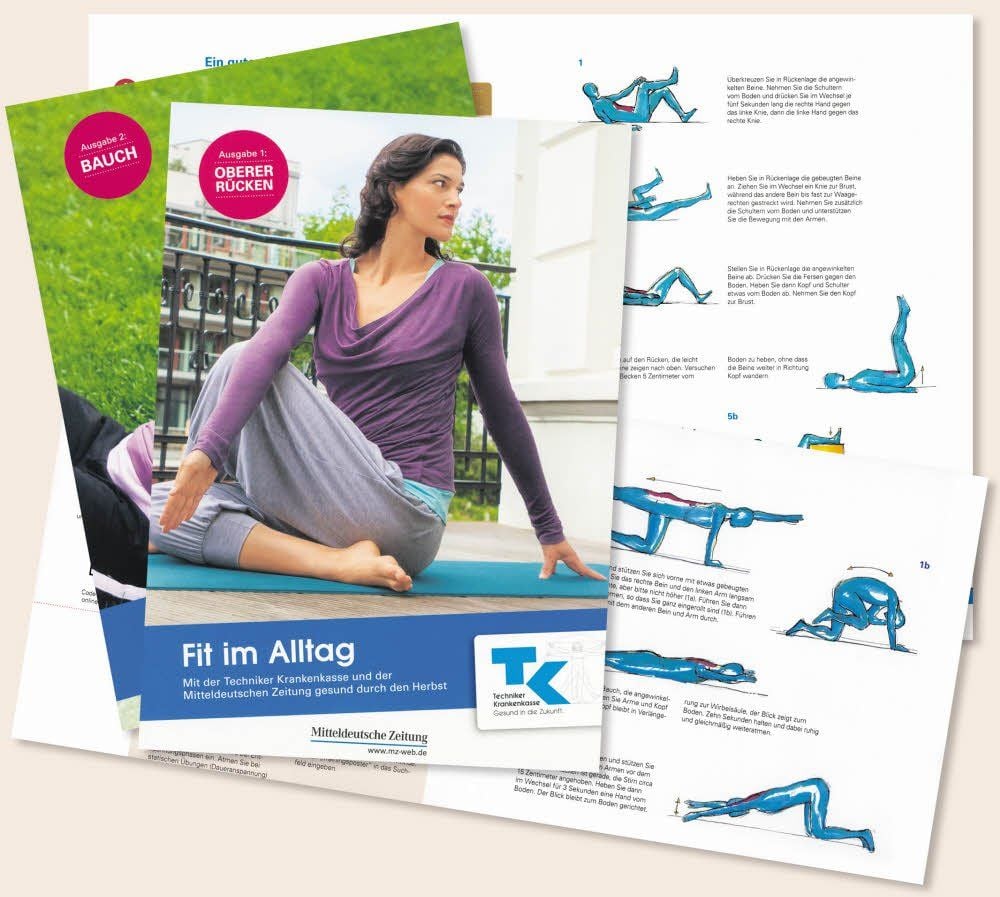
Halle/MZ - Honigsüßer Durchfluss - das klingt fast poetisch. Dabei handelt es sich um die wörtliche Übersetzung des Namens einer Krankheit, die in Deutschland für etwa sieben Millionen Menschen einen tiefen Einschnitt in ihr Leben bedeutet: Diabetes mellitus - auch Zuckerkrankheit genannt.
„Der Name geht darauf zurück, dass der schlecht eingestellte Diabetiker Zucker durch die Nieren in den Urin verliert. Dann wird der Urin richtig süß“, erklärt Professor Matthias Girndt, Direktor der Klinik für Innere Medizin II der Martin-Luther-Universität Halle. „Übrigens“, so fährt er fort, „haben die Ärzte das in früheren Zeiten abgeschmeckt, um so den Diabetes zu diagnostizieren.“ Heute gebe es da andere Möglichkeiten. Dennoch - das sei noch gar nicht so furchtbar lange her.
Noch gar nicht so furchtbar lange her ist es auch, dass die Ärzte der Zuckerkrankheit relativ machtlos gegenüberstanden. „Es gab bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts keine spezifischen Behandlungsmöglichkeiten für Diabetiker, weder Tabletten noch Spritzen“, erzählt Matthias Girndt. Die Krankheit habe sehr schnell zum Tode geführt. Das änderte sich erst, als Anfang der 1920er Jahre von dem kanadischen Arzt Frederick Banting und seinen Kollegen das Insulin entdeckt wurde und bald darauf aus den Bauchspeicheldrüsen von Rindern und Schweinen großtechnisch gewonnen werden konnte.
Das Insulin spielt beim Diabetes die entscheidende Rolle. „Es ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und dafür sorgt, dass unser Blutzuckerspiegel normale Werte hat“, sagt Matthias Girndt. Bei einem zuckerkranken Menschen funktioniere das nicht mehr.
Dabei sind zwei Typen zu unterscheiden. Beim Typ-1-Diabetiker werden durch Entzündungsprozesse die Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört, die das Insulin produzieren. Der Patient muss sofort und für sein gesamtes weiteres Leben lang mit Insulin behandelt werden.
Schreiben Sie uns, was Sie tun um fit zu werden oder zu bleiben: Mitteldeutsche Zeitung, 06075 Halle oder per Mail.
Anders sieht es beim Typ-2-Diabetes aus, an dem übrigens 90 Prozent aller Diabetiker leiden. Neben einer genetischen Veranlagung sei es vor allem Übergewicht, das zur Krankheit führe, sagt Matthias Girndt. Meist in Kombination mit Bewegungsmangel. „Hier wird die Bauchspeicheldrüse überfordert. Sie produziert immer mehr Insulin, auf das der Körper am Ende nicht mehr anspricht“, erklärt der Mediziner. Insulinresistenz ist das Fachwort dafür. In der Folge steige der Zuckerspiegel im Blut. „Das ist aber ein längerer Prozess und deshalb müssen am Anfang der Behandlung nicht gleich Insulingaben stehen.“
Was aber hilft dann? „Neben Tabletten sind es vor allem eine geeignete Ernährung und körperliche Aktivität“, sagt Matthias Girndt. Insulin sei hier die letzte Form der Behandlung.
Der Typ-2-Diabetes wird auch Alterszucker genannt. Tatsächlich sind laut einer Statistik des Berliner Robert-Koch-Institutes vor dem 45. Lebensjahr nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Danach steigen die Zahlen rapide an. In der Altersgruppe ab 65 Jahren betrifft die Krankheit schon etwa 16 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer. „Aber“, so sagt der Spezialist, „ich habe noch gelernt, dass es den Typ-2-Diabetiker nur bei Erwachsenen gibt.“ Das stimme nicht mehr. „Die Kollegen aus der Kindermedizin sehen zunehmend mehr Kinder und Jugendliche, die darunter leiden.“ Das sei eine erschreckende Entwicklung. Und auch deren Ursache sei Übergewicht.
Sie möchten die sportlichen Tipps in Ihren Alltag integrieren? Die Beilage können Sie der MZ vom Samstag entnehmen.
Die Mitteldeutsche Zeitung können Sie an allen bekannten Verkaufsstellen und allen MZ-ServiceCentern erwerben.
Warum aber ist Diabetes so gefährlich? „Ein hoher Blutzuckerspiegel zieht viele Folgekrankheiten nach sich“, antwortet der Mediziner. Und er zählt auf: Erkrankungen des Blutkreislaufes, Durchblutungsstörungen der Herzkranzarterien bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall, Durchblutungsstörungen in den Beinen bis hin zu Amputationen, unangenehme Gefühlsstörungen in den Beinen - die Patienten spüren nicht mehr, wenn sie sich stoßen und verletzen. Das sei oft der Anfang des sogenannten diabetischen Fußes, der schlecht heile. Der Arzt weist auf Erkrankungen des Augenhintergrunds hin. Der Diabetiker, so betont er, könne potenziell sein Augenlicht verlieren.
Damit noch nicht genug. Auch die Nieren können betroffen sein. „Nierenversagen, das durch die Zuckerkrankheit entsteht, ist in Deutschland die häufigste Ursache für die Dialyse“, sagt Matthias Girndt. Er weiß wovon er spricht, denn er ist zugleich ärztlicher Leiter des KfH-Nierenzentrums am Universitätsklinikum Halle - ein Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation.
Vergleichsweise harmlos klingt da die verstärkte Anfälligkeit für Infekte. „Sie verlaufen beim Diabetiker aber oft schwer, häufig entwickelt sich eine Lungenentzündung“, sagt der Arzt. „Deshalb ist es mir ganz wichtig, dass sich Diabetiker jetzt im Herbst gegen Grippe impfen lassen.“
Der Typ-2-Diabetes bleibt oft lange Zeit unentdeckt. „Wenn bereits die Großeltern und Eltern zuckerkrank waren, ist das Risiko, selbst erkrankt zu sein, hoch“, unterstreicht der Mediziner. Käme dann noch Übergewicht dazu, sei es sinnvoll, beim Hausarzt entsprechende Kontrollen durchführen zu lassen. Beim Check-up 35, den gesetzlich Krankenversicherte alle zwei Jahre beanspruchen können, gehört die Messung der Blutzuckerwerte dazu. In Sachsen-Anhalt nehmen das nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung lediglich 43 Prozent der Versicherten wahr.
„Wenn die Zuckerkrankheit akut ausbricht, verspüren die Betroffenen großen Durst. Hinzu kommen eine allgemeine körperliche Schwäche, Zittrigkeit, Müdigkeit, mitunter Sehstörungen“, erläutert der Diabetes-Experte. Und so eine Blutzuckerentgleisung könne auch lebensgefährlich sein.
Doch anders als beim Typ-1-Diabetes, der die Patienten schicksalhaft trifft, kann der Typ-2-Diabetiker eine ganze Menge gegen seine Krankheit tun, und möglicherweise Folgeerkrankungen vermeiden. „Durch Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität und eine geeignete Ernährung, die viel Gemüse, pflanzliche Produkte und wenig Zucker enthält, kann er die Zuckerkrankheit zurückdrängen. Es gelingt vielen Patienten, auch wieder auf normale Zuckerwerte zu kommen und Zeit zu gewinnen, bis die Krankheit wirklich behandelt werden muss“, sagt Matthias Girndt. Und selbst wenn die Krankheit bereits manifest sei, könne so oft lange Zeit verhindert werden, dass sich der Patient auf viele Medikamente oder gar Insulin verlassen müsse.
Der Arzt weiß natürlich, dass es eine Herausforderung ist, sich jeden Tag 30 Minuten lang körperlich zu betätigen. Gehen, Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen - alle Arten von Ausdauersport seien gut geeignet. Und alles in moderatem Tempo. „Aber 30 Minuten am Tag sind machbar“, fügt er hinzu. „Wer sieht, wie schlimm die Folgeerkrankungen sind, ist dazu vielleicht motiviert.“ Allerdings ist dabei eines wichtig - besonders für Diabetiker mit einer Insulin-Therapie. „Der Diabetiker lernt, wie er sich selbst den Blutzucker misst, die nötige Insulin-Dosierung bestimmt und sich dann auch selbst verabreicht“, erklärt Matthias Girndt. Wenn nun bei der sportlichen Aktivität mehr Zucker verbraucht werde als ursprünglich abgeschätzt, könne es zu einer Unterzuckerung kommen. Die sei mitunter sogar lebensgefährlich. „Die schnellste Hilfe ist es dann, dem Betreffenden Zucker zu geben.“ In der Regel hätten Diabetiker für solche Notfälle immer Würfel- oder Traubenzucker bei sich.
Diabetiker werden heute in der Regel beim Hausarzt in sogenannten Disease Managemant Programmen (DMP) betreut. Diese strukturierten Behandlungsprogramme, führen dazu, dass sie unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle stehen und Komplikationen früh erkannt werden. Ein Erfolgsprogramm nennt sie Matthias Girndt. Dort lernen Diabetiker auch, wie sie sich zweckmäßig ernähren und möglicherweise das eine oder andere Kilogramm verlieren. Der Mediziner macht in diesem Zusammenhang auf ein Problem aufmerksam, das viele Diabetiker belastet. „Einige Tabletten und vor allem Insulin führen dazu, dass der Körper Zucker ins Gewebe einbaut, zu Fett umwandelt und speichert“, erklärt Matthias Girndt. Anders ausgedrückt: Ein Diabetiker, der viel Insulin braucht, bekommt viel von dem Hormon, das Fett aufbaut. Das führe zu einer Gewichtszunahme und langfristig auch dazu, dass der Zucker immer schwerer einzustellen sei. „Dieser Teufelskreis ist nur zu durchbrechen, wenn der Betreffende wenig isst“, sagt der Arzt. Unglücklicherweise mache Insulin aber auch Hunger.
Dennoch - ein Diabetiker muss nicht allem entsagen. „Bei einer Feier kann schon mal ein Auge zugedrückt werden“, meint der Spezialist. Auch gegen Alkohol in Maßen sei nichts einzuwenden. Er warnt aber davor, nur mit „zugedrückten“ Augen herumzulaufen. Und ganz streng wird er beim Rauchen. „Der Diabetiker, der raucht, handelt grob fahrlässig“, unterstreicht Matthias Girndt. Seine Gefäße seien durch die Grunderkrankung schon stark belastet, wenn er nun noch rauche, stellten sich mit Sicherheit Komplikationen ein.
Kann ein Diabetiker, der sich an alle Regeln hält, also relativ normal alt werden? „Grundsätzlich ja“, sagt der Arzt. Aber es gelinge nicht allen. Er verweist auf die genetische Komponente der Krankheit. „Es gibt Menschen“, so sagt er, „die werden zuckerkrank und haben im Prinzip keine Chance.“ Warum? Das sei auch heute noch unklar.
Schreiben Sie uns, was Sie tun
um fit zu werden oder zu bleiben: Mitteldeutsche Zeitung, 06075 Halle oder per Mail an: [email protected]





