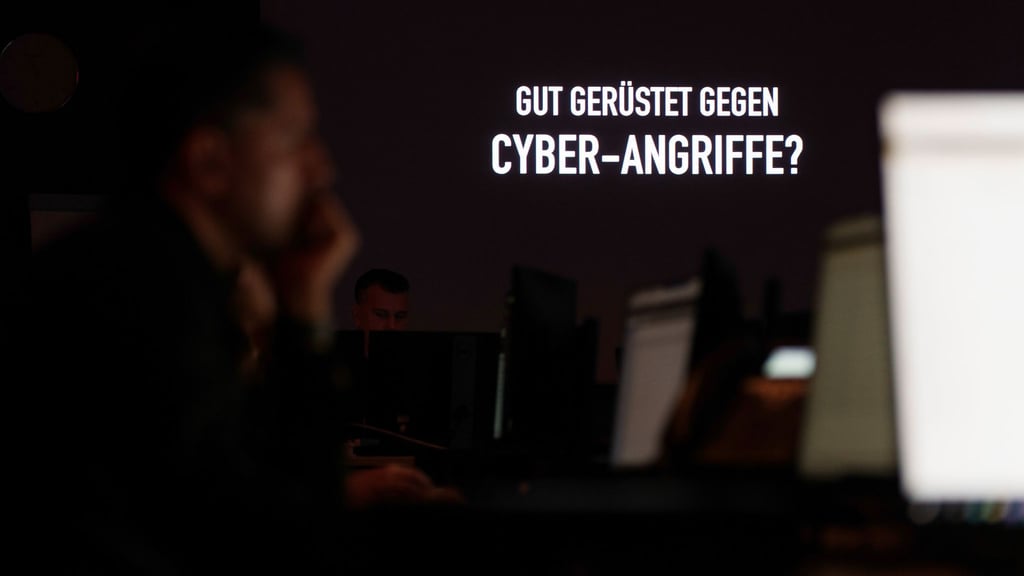Weltbekannt und unbekannt - Die Manufaktur Isdera
Leonberg/dpa. - Isdera, was ist das? So dürften die meisten Gespräche beginnen, in denen der Name des großen Unbekannten unter den deutschen Autoherstellern erwähnt wird.
Nur Experten werden sich an dessen Großtaten erinnern. Doch obwohl der Name so unbekannt ist, sind die Produkte weltbekannt: Wann immer ein neues Modell anrollte, folgte weltweit großer Medienrummel. Da die Autos in winzigen Stückzahlen gefertigt wurden, kommt es heute nur äußerst selten zur Begegnung mit einem Isdera.
Die Marke basiert auf nur einer Person: Eberhard Schulz. Er fing in den 60ern in Ostfriesland damit an, sein eigenes Auto zu bauen. Das Ergebnis war ein reinrassiger Sportwagen mit Flügeltüren, 400 PS und einem Höchsttempo von mehr als 300 km/h - der Name: Erator GT.
Der Legende nach setzte sich Schulz eines Tages in den Wagen, um sich bei Mercedes und Porsche zu bewerben: Er habe keinen Abschluss, als Referenz stehe aber der Erator GT auf dem Parkplatz. Die Legende geht so weiter, dass sich Schulz 1971 mit Porsche einigte - und dann die Arbeit am zweiten Auto aufnahm, mit Mercedes' 300 SL Flügeltürer als Vorbild.
Das Ergebnis war ein flacher, kantiger Sportwagen, der in unter fünf Sekunden auf Tempo 100 katapultiert werden konnte und sich erst bei 319 km/h vom Fahrtwind in die Schranken weisen ließ. Der Wind soll den Namen geprägt haben: CW 311 steht für den CW-Wert von 0,311.
Inzwischen war 1978 - und für Schulz sollte es eigentlich erst losgehen. Er lernte den Tuner Rainer Buchmann kennen, dessen Firma b+b zu den Großen gehörte. Schulz verließ Porsche und machte bei Buchmann mit. Doch man zerstritt und trennte sich bald. Im Jahr 1982 gründete Schulz endlich Isdera - ein Kurzwort für «Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing». Geld kam durch Entwicklungen für andere rein. Doch Schulz wäre nicht Schulz, hätte er nicht weiter eigene Autos entwickelt. Waren seine Mobile bisher Einzelstücke, gab es den Isdera spyder 036i für gutes Geld zu kaufen.
Die Optik stimmte: Es waren wieder die Grundzüge des CW 311 zu erkennen. Den hatte Schulz bei b+b lassen müssen, was ihn aber nicht daran hinderte, an einer modifizierten Neuauflage zu arbeiten. Die wurde als Isdera imperator 108i in Serie produziert. Wobei «Serie» Humbug ist: Bis heute sollen kaum 50 Isdera-Autos entstanden sein. Immerhin zeigte die Straßenversion, dass die Daten der Unikate keine Träumereien waren: Je nach Motor soll ein imperator es auf bis zu 310 km/h geschafft haben. Als Antrieb dienten modifizierte Motoren von Mercedes mit acht Zylindern und bis zu 410 PS. Das alles sorgte für besagtes großes Trara.
Doch in den späten 80ern verblasste der Ruhm in der Öffentlichkeit so langsam. Das änderte Schulz 1993 mit dem Isdera commendatore 112i. In jeder Hinsicht war das noch einmal eine Steigerung gegenüber den Ur-Modellen. Der Motor kam wieder von Mercedes und hatte jetzt zwölf Zylinder: Bis zu 6,9 Liter Hubraum waren möglich und bis zu 620 PS.
Dass der commendatore einem irgendwie bekannt vorkam, hatte einen einfachen Grund: Die Scheinwerfer kamen aus dem Porsche 986. Geht es um Preise, ist mal von 300 000, mal von 800 000 zu hören, mal in Mark und mal in Euro. Im Endeffekt ist das aber auch egal: Nur zwei sollen gebaut worden sein.
Danach schien es so, als wäre Schulz zur Ruhe gekommen. Dass das falsch war, sollte sich 2006 zeigen, als Isdera den autobahnkurier 116i ankündigte. Das Einzelstück erinnert an luxuriöse Sportler aus den 30ern, ist aber unter dem Blech nicht gestrig: Zwei Achtzylinder mit insgesamt 600 PS arbeiten dort.
Wer bei Türen und Dach an alte VW-Käfer denken muss, irrt nicht. Die Tatsache, dass an einem so ungewöhnlichen Auto ausgerechnet auch Käfer-Teile verwendet wurden, mag manchem seltsam vorkommen. Aber es ist eben ein Isdera - und die waren immer anders als andere. Das ist ein guter Grund, die Marke nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.