Wissenschaft und Ethik Wissenschaft und Ethik: Wegweiser für die Forschung
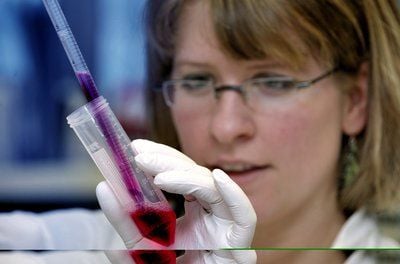
Halle/MZ. - So sei es auch mit embryonalen Stammzellen, wenngleich die Uni auf diesem Gebiet nicht selber forscht. Sie könnten "vermitteln, wie bestimmte Abläufe funktionieren", sagt Klöss. Sie könnten der Forschung "Wege weisen", ergänzt Prof. Dr. Dieter Körholz, Leiter der Uni-Kinderklinik. Auch der Forschung an adulten, also spezielleren Stammzellen aus dem menschlichen Körper, wie sie am Uni-Klinikum praktiziert wird.
Europaweite Regelung
Die halleschen Experten sprechen sich deshalb für eine Ausweitung der Forschung mit embryonalen Stammzellen aus. Klöss hält eine europaweite rechtliche Regelung für sinnvoll, die es erlaube, auch in Deutschland unter strenger Kontrolle solche Zellen zu Forschungszwecken herzustellen.
Bisher ist das verboten. Vielmehr darf in der Bundesrepublik derzeit nur mit embryonalen Stammzellen gearbeitet werden, die vor dem 1. Januar 2002 im Ausland gewonnen wurden. Aus Sicht der Wissenschaftler ist diese Regelung unzureichend - nicht nur, weil die zugelassenen Zellen wegen ihres Alters nicht mehr so gut verwendbar sind, sondern auch aus ethischen Gründen. Eine Verlängerung der Stichtagsfrist - eine der Optionen, über die am Freitag der Bundestag entscheidet - ändere an diesem Grundproblem nichts, sagt Körholz. "Der Stichtag trägt nicht." Damit werde die Verantwortung schlicht ins Ausland verlagert, was moralisch fragwürdig sei, fügt er hinzu. "Ehrlicher wäre es, klare Regeln zu definieren, selber herzustellen und zu kontrollieren."
Rasante Dynamik
Entscheiden müsse die Politik, betonen die Wissenschaftler. Es sei "eine prinzipielle Frage", ob Deutschland sich "mit aus ethischer Sicht guten Gründen" von der Stammzellenforschung distanzieren oder "als Forschungsstandort mithalten" wolle, meint Dr. Lutz-Peter Müller von der Uni-Klinik für Onkologie und Hämatologie. "Bei der Dynamik, die auf diesem Gebiet entsteht", warnt der Experte, "haben wir allein keine Chance."
Noch ganz am Anfang
Müller ist Projektleiter in einer Forschungsgruppe, die der Frage nachgeht, wie sich bestimmte adulte Stammzellen in andere Zelltypen umwandeln lassen, um so Krankheiten heilen zu können. Bisher ist das nicht möglich: Die Fähigkeit adulter Stammzellen, sich zu anderen Zellen zu entwickeln, ist begrenzt - im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen. "Stammzellen, die für die Bildung von Bindegewebe verantwortlich sind, lassen sich derzeit nicht für innere Organe einsetzen", gibt der Mediziner ein Beispiel. "Es geht uns darum, diese Grenzen zu überwinden, wir stehen da aber noch ganz am Anfang." Die Erfahrungen mit embryonalen Stammzellen, sagt Müller, könnten bei der Arbeit helfen. Als Wegweiser.




