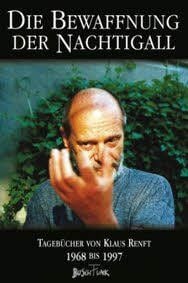Tagebücher von Klaus Renft Tagebücher von Klaus Renft: Vom Rockerleben in der DDR

Löhma - Er hatte diese seltsame Angewohnheit, die ihn unverkennbar machte. Wenn Klaus Renft auf die Bühne ging, dann schnallte er sich seinen Bass zuvor um wie kein anderer Bassist: Der breite Ledergurt lief über die Schulter des Mannes, den alle nur „Jenni“ nannten. Und von dort zwischen seinen Beinen zurück zum Instrument. Klaus Renft wollte ihn nicht nur bedienen, nein, er wollte ihn spüren, seinen Bass.
Den spielte der gebürtige Thüringer mit mehr Hingabe als Kunstfertigkeit, wie er selbst gestand. Klaus Renft, in Jena als Klaus Jentzsch geboren und schon mit 16 Jahren Gründer seiner ersten Band, war von Haus aus Musiker, erst bei den Butlers, dann bei der legendären Renft-Combo. Doch sein wirklich großes Talent bestand darin, Leute zusammenzubringen und aus ihren Talenten mehr zu machen als die Summe aller Teile.
Von 1958 an, als er die erste Renft-Band, so benannt nach dem Mädchennamen seiner Mutter, zusammenrief, war Klaus Renft unter den schwierigen Bedingungen der Rock-Produktion in der DDR ein Macher, ein Organisator, ein Querkopf und Schelm. „Ich war in meinem Leben mehr verboten als erlaubt“, sagte er von sich. Das klang nicht etwa larmoyant, sondern humorvoll: Auf dem Gipfel ihrer Schöpferkraft hatten die DDR-Kulturbürokraten die Band Renft im Jahr 1975 verboten. Mit dem Erfolg, dass aus der Gruppe in den Jahren danach eine Legende wurde, unfassbar und unsterblich.
Von innen betrachtet aber sah das alles ganz anders aus, wie die jetzt von Renfts Lebensgefährtin Heike Stephan und der aus Sangerhausen stammenden Schriftstellerin Undine Materni veröffentlichten Tagebücher des vor neun Jahren an einem Krebsleiden verstorbenen Musikers und Malers zeigen. Der Mann, der Renft war, hatte zwischen 1968 und 1997 regelmäßig notiert, welche Fragen ihn bewegten, welche Hindernisse sich zwischen ihm und seinem großen Traum von Rock’n’Roll auftürmten und welche Überlegungen er anstellte, um im Klima andauernden Misstrauens Rockmusikern gegenüber auftreten und Platten machen zu dürfen.
Wie Klaus Renft unter dem Misstrauen und den Maßregelungen gelitten sowie mit internen Meinungsverschiedenheiten in seiner Band gekämpft hat, lesen Sie auf der nächsten Seite.
„Die Bewaffnung der Nachtigall“ haben Stephan und Materni das Buch genannt, das auf 239 Seiten in ausgewählten Notizen ein ungeschminktes Innenbild des Lebens eines Überzeugungstäters zeichnet. Klaus Renft, im Hauptberuf anfangs Verkäufer in einer Leipziger Musikalienhandlung, ist so etwas wie der Forrest Gump der Populärmusik der DDR. Als die ersten jungen Männer sich elektrische Gitarren umschnallen, ist er dabei. Als junge Leute beim Beataufstand in Leipzig gegen die rigorose Verbotspraxis der Behörden auf die Straße gehen, ist er der Anlass. Buschfunk-Chef Klaus Koch, der Renfts Tagebücher verlegt hat, lernte den Mann mit der ewig qualmenden Pfeife kennen, als dessen Combo 1972 vergebens nach dem Kulturhaus in Pretzsch an der Elbe suchte. „Auf einmal standen sie bei meinen Eltern im Wohnzimmer - in Bad Schmiedeberg.“ Nette junge Leute, die noch mit der Familie frühstücken, ehe sie schließlich zu ihrem Konzert aufbrechen.
Nach Beginn des kulturellen Tauwetters spielt seine Band beim Jugendfestival der FDJ vor tausenden Fans, doch als sie beginnt, immer kritischere Töne anzuschlagen, ist sie auch die erste, die trotz ihrer Popularität mit einem Entzug der Spielerlaubnis samt DDR-weitem Berufsverbot bestraft wird.
Klaus Renft hat unter dem Misstrauen und den Maßregelungen gelitten, mehr aber hatte er noch zu kämpfen mit den internen Meinungsverschiedenheiten in seiner Band. Eine Fraktion wollte im Duell mit dem Staat einlenken, eine andere den offenen Krieg riskieren. Renft, ein sanfter, gutmütiger Mann, der sein Leben lang nicht aufhörte, im weichen Thüringer Singsang zu sprechen, mühte sich zu vermitteln. Und scheiterte. „Man kann in einem Land nicht leben, aus dem man nicht auswandern kann“, hatte Sänger Thomas Schoppe bei einem Konzert in Karl-Marx-Stadt unabgesprochen von der Bühne gerufen. Das Publikum tobte, Klaus Renft, der müde Mittler, suchte die Kraftprobe mit seinen Bandkollegen und verlor: Sie setzten ihn als Bandchef ab. Wenig später gab es Renft nicht mehr.
All die Zweifel, die den damals gerade 33-Jährigen plagten, aber auch sein unbedingtes Bekenntnis zur Solidarität mit seinen Kollegen, die von der Stasi neutralisiert werden sollen, schreibt Klaus Renft auf. Manchmal in Prosa, manchmal in langen Listen und Plänen, manchmal auch in Gedichten, aus denen unter anderen Umständen vielleicht wunderbare Renft-Songs geworden wären. (mz)