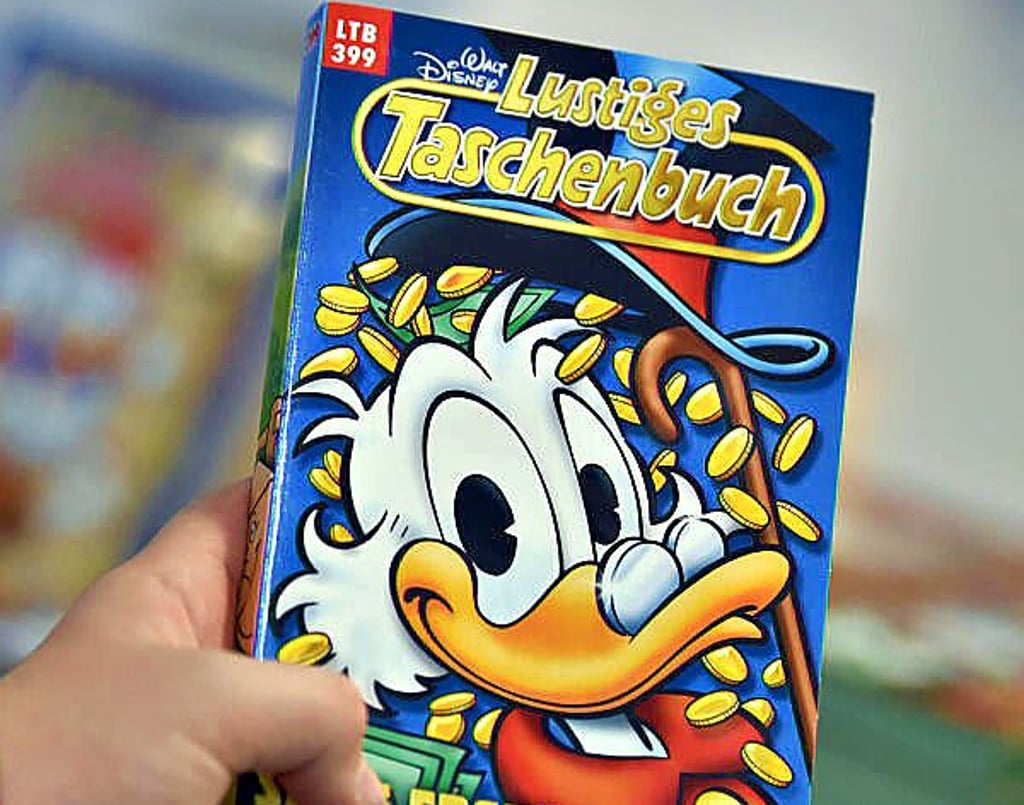Psychoanalytiker Mitscherlich wäre 100 geworden
Frankfurt/Main/dpa. - Er war einer der ersten wissenschaftlichen Medienstars: Alexander Mitscherlich zeigte in den 1960er Jahren eine öffentliche Präsenz wie kaum ein anderer.
Der Psychoanalytiker, der am 20. September 100 Jahre alt geworden wäre, hatte keine Scheu, zu nahezu allen Fragen des öffentlichen Lebens Stellung zu beziehen. «Mitscherlich gehörte zu den markantesten Persönlichkeiten, die der geistigen Physiognomie der Bonner Republik ihren Stempel aufgedrückt haben», sagt Timo Hoyer, Autor der Mitscherlich-Biografie «Im Getümmel der Welt»; sie erschien im August bei Vandenhoeck&Ruprecht. Vor allem aber «trug er entscheidend dazu bei, die Psychosomatik und die Psychoanalyse im Nachkriegsdeutschland institutionell zu verankern».
Der Sohn eines Chemikers wurde am 20. September 1908 in München geboren und wuchs in Hof auf. Seine Dissertation in Geschichte brach er ab, als sich ein antisemitisch eingestellter Professor weigerte, die Arbeiten seines jüdischen Vorgängers weiter zu betreuen. Mitscherlich ging nach Berlin, wo er als Buchhändler und Lektor arbeitete. Als er - als Mitarbeiter eines Widerstands-Verlags - steckbrieflich gesucht wurde, ging Mitscherlich in die Schweiz. 1937 wurde er auf einer Reise durch Deutschland verhaftet und für einige Monate inhaftiert.
In Zürich studierte Mitscherlich Medizin. In Heidelberg arbeitete er zunächst als Neurologe und begründete 1949 eine psychosomatische Abteilung an der Universität Heidelberg, die später zur ersten Klinik dieser neuen Fachrichtung in Deutschland ausgebaut wurde. Sein späteres Leben sollte allerdings die Psychoanalyse dominieren. 1959 gründete er in Frankfurt das Sigmund-Freud-Institut, eine psychoanalytische Forschungs- und Ausbildungsstätte, die er bis 1976 leitete. 1982 starb er nach langer Krankheit und Demenz 73-jährig in Frankfurt und hinterließ seine dritte Frau Margarete und sechs Kinder.
«Alexander Mitscherlich hat die Psychoanalyse in der Bundesrepublik neu begründet, und das kam, nach dem Kahlschlag unter Hitler, nahezu der Arbeit gleich, sie neu zu erfinden», schrieb der «Spiegel» in seinem Nachruf 1982. Mitscherlich behandelte keineswegs nur Einzelpersonen - er therapierte gleichsam die gesamte Nachkriegsgesellschaft. Soziologische und psychoanalytische Forschung sah er «als natürliche Verbündete» an und hat damit «die Freudsche Lehre in einem entscheidenden Punkt weitergedacht», wie die «Süddeutsche Zeitung» zu seinem 70. Geburtstag schrieb. Kein geringerer als der Philosoph Jürgen Habermas bescheinigte Mitscherlich «diagnostische Schärfe».
Mit dem geübten Blick des Analytikers blickte Mitscherlich auf die Gesellschaft, attestierte ihr eine «Unfähigkeit zu trauern» (1967) und untersuchte «Eine deutsche Art zu lieben» (1970). Auch die Sünden der Medizin im Dritten Reich («Medizin ohne Menschlichkeit», 1960) oder architektonische Fragen («Die Unwirtlichkeit unserer Städte», 1965) beschäftigten ihn. Als sein wichtigstes Werk gilt «Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft» (1963), in dem er zeigt, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, die Abschied nimmt von symbolischen Vorbildern und Idealen.
Bereits in den 70er Jahren ging es mit seiner Popularitätskurve stetig bergab, wie Biograf Hoyer zugeben muss. «Er war ein Zeitgeistautor - im guten Sinne»: Er hatte eine Gabe, den Zeitgeist zu erkennen, bevor dieser sich manifestiert hat, und ihn treffend in Worte zu fassen. Inzwischen hätten manche Texte allerdings doch «ein bisschen Patina angesetzt». Das Sigmund-Freud-Institut widmet seinem Gründer zum 100. Geburtstag eine internationale Konferenz (25. bis 29.9.), die sich mit der «Ambivalenz des medizinisch-technischen Fortschritts» beschäftigt.