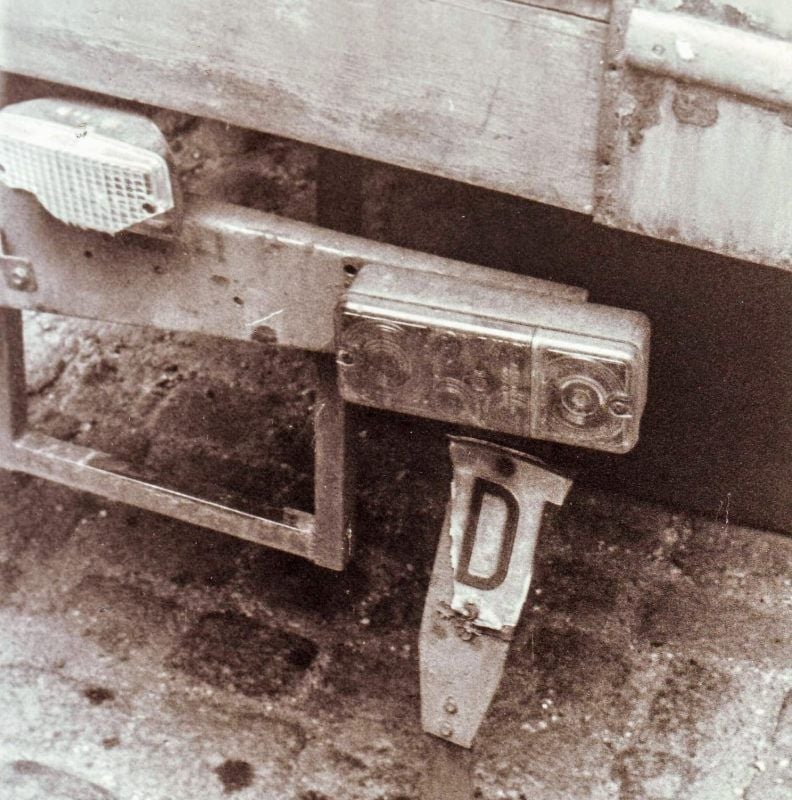"Entwertung ostdeutscher Kultur" Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk zieht ernüchternde eine Bilanz der Wiedervereinigung
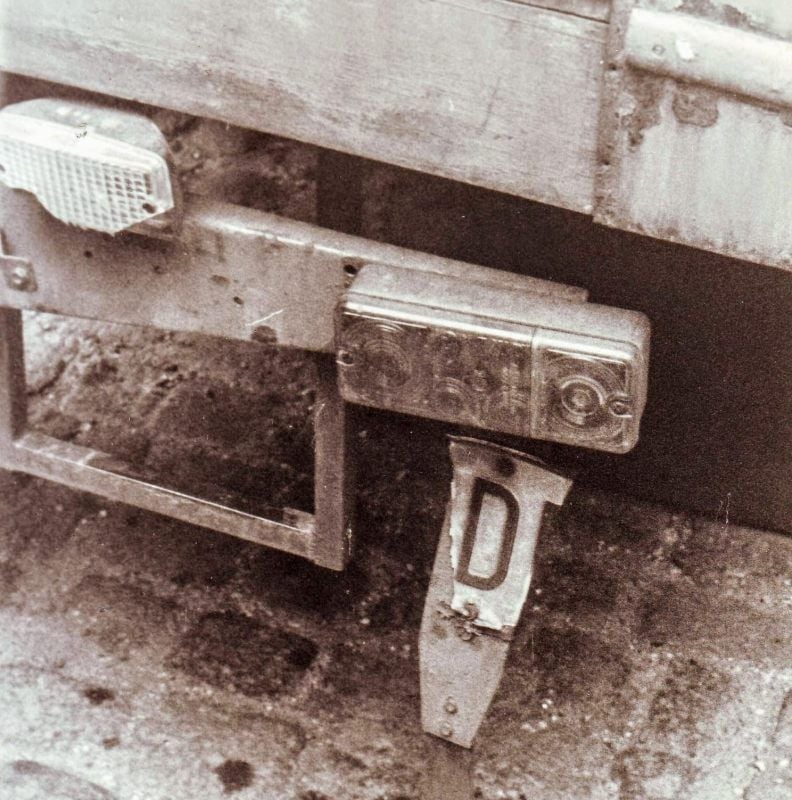
Halle (Saale) - Der Titel ist zugespitzt, aber immerhin nicht so weit, wie es möglich gewesen wäre. Statt der in der Wirtschaft üblichen Bezeichnung „feindliche Übernahme“ belässt es der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk für sein neues Buch bei einem sachlichen „Die Übernahme“ - doch weil der Untertitel „Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“ lautet, ist auch das schon Provokation.
Denn ausgerechnet im 30. Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution in der DDR und kurz vor dem in zwölf Monaten anstehenden 30. Jahrestag der deutschen Einheit misst der 1967 in Ostberlin geborene ausgewiesene Kenner der Umbruchzeit zwischen 1989 und 1990 nach: Was wurde von den einst gehegten euphorischen Erwartungen in Ost und West eingelöst?
Zahlen, Fakten, Einzelschicksale - Autor beschreibt „deutsch-deutsche Schieflage“
Und was ist auch nach drei Jahrzehnten unerfüllt geblieben? Kowalczuk, der zu DDR-Zeiten Baufacharbeiter lernte, weil er kein Abitur machen durfte, und danach als Pförtner arbeitete, bis er 1990 doch noch einen Studienplatz erhielt, ist keiner, der Erfolge gering schätzt.
Als er daranging, aus Zahlen, Fakten, Einzelschicksalen und Statistiken eine Gesamtschau der Vorgänge von damals bis heute zu entwerfen, sagt er, sei ihm „die Wucht der ganzen deutsch-deutschen Schieflagen selbst etwas übertrieben“ vorgekommen. „Aber ich kann sie nicht ändern, sie stellen eine Realität dar.“
„Zusammenbruch der Arbeitsgesellschaft“ - Kollateralschäden der Wiedervereinigung?
Es ist Geschichte, aber die lebt noch, atmet und wirkt auf die Gegenwart ein wie die Wahlen in Brandenburg und Sachsen eben erst wieder gezeigt haben. Der Osten fühlt anders, denkt anders und er hat immer noch nicht verarbeitet, wie binnen kürzester Zeit alle Gewissheiten fortgeblasen wurden und alle Sicherheiten sich in einem Sturm auflösten, der innerhalb von 13 Monaten ein ganzes Land verschwinden ließ. Die Dynamik der Ereignisse fraß mit atemberaubender Geschwindigkeit nicht nur die Repräsentanten des Regimes, sondern auch die Bürgerrechtler, die die „Freiheitsrevolution“ (Kowalczuk) anfangs anführten.
Den „Zusammenbruch der Arbeitsgesellschaft“, nennt Kowalczuk die Kollateralschäden der von einer großen Mehrzahl der DDR-Bürger herbeigesehnten Wiedervereinigung. Ein Zusammenbruch, der aufgrund der kollektivierten DDR-Gesellschaft mehr bedeutete als nur Arbeitslosigkeit und Zukunftsungewissheit. „Die Menschen verloren nicht nur ihre Arbeit, sie verloren ihren sozialen Status, sie verloren ihren kulturellen Status.“
Zeit, Rücksicht auf diesen Aspekt des Umbruchs zu nehmen, war nicht: Es galt, die Strukturen der alten Bundesrepublik schnellstmöglich auch in den neuen Ländern funktionsfähig zu machen. Und dazu fand dann eben ein „Austausch von Führungskräften größten Ausmaßes statt, so wie ihn zu Friedenszeiten noch keine Gesellschaft erlebt hatte“.
Autor Kowalczuk: „Abmachungen aus dem Einheitsvertrag wurden nicht konsequent umgesetzt.“
Nein, Kowalczuk benutzt das Wort „Kolonisierung“ zwar auch, aber er nimmt es gleich wieder zurück. Die Aufbauhelfer aus dem Westen kamen nicht als Kolonialherren. Sie wurden in Unternehmen, Behörden und Institutionen nur oft als solche empfunden. Empfindlichkeiten, die der 52-Jährige Wunden zuschreibt, die schon während der Einheitsverhandlungen geschlagen wurden.
Weder verhandelte DDR-Unterhändler Günther Krause auf Augenhöhe mit seinem bundesdeutschen Gegenüber Wolfgang Schäuble, der am Ende eher einen Vertrag mit sich selbst geschlossen habe. Noch seien Abmachungen aus dem Einheitsvertrag wirklich durchweg umgesetzt oder auch nur der Verfassungsauftrag ernstgenommen worden, nach Vollendung der Einheit eine gemeinsame neue Verfassung für das gesamte deutsche Volk zu erarbeiten und verabschieden zu lassen. Stattdessen tabula rasa: Die Ostdeutschen, die eben erst ihre eigene Kraft entdeckt hatten, wurden an die Hand genommen und geführt.
Ilko-Sascha Kowalczuk attestiert einer Mehrheit von ihnen, dass es ihr ganz recht so gewesen sei. Die „Entwertung ostdeutscher Kultur“, die mit der Vereinigung von der Treuhand vorgenommene Umverteilung von Eigentum von Ost nach West und der Verlust der Deutungshoheit über die eigene Geschichte ließen im Osten jedoch zugleich ein Gefühl entstehen, dass die Einheit eher einer Übernahme gleiche als dem Zusammengehen Gleicher. Das pure Glück, in das sich die Hoffnungslosigkeit Ende 1989 verwandelte, die viele noch eine halbes Jahr zuvor verspürt hatten, „barg einen sehr hohen Enttäuschungsfaktor in sich“, schreibt Kowalczuk.
Ilko-Sascha Kowalczuk: „Wünschenswert wäre eine Gesellschaftsaussprache.“
Ganze Alterskohorten hätten nie die Chance bekommen, neu anzufangen. Bürgerrechtler verloren die gerade gewonnene Selbstbestimmung. Parteitreue Funktionäre ebenso wie Millionen normaler Arbeiter und Angestellter den Job und Kinder ihre Eltern, weil die pendeln mussten oder in Depressionen versanken.
Enttäuschung grummelt nun in einer tief gespaltenen, in sich zerrissenen und mit sich uneinigen Gesellschaft, die Ilko-Sascha Kowalczuk als prototypisch für andere sieht, denen in Zukunft ähnliche, diesmal durch die Globalisierung verursachte harte Umbrüche erst noch bevorstehen. „Wünschenswert“, sagt er mit Blick auf den Osten, „wäre eine Gesellschaftsaussprache - woher, wohin?“
Doch noch immer habe niemand dafür Zeit, Ressourcen, Kraft. „Die Milieus reden aneinander vorbei.“ Die Annahme, sozialer Frieden und Wohlstand allein verwandelten die Ostdeutschen allesamt in glühende Verfechter der westlichen Ordnung, sei ein Irrtum gewesen. „In dem Maße, wie sie sozial im Westen angekommen waren, fingen sie an, sich von ihm zu distanzieren.“
Wiedervereinigung: Einheit oder Übernahme?
Der Osten habe sich als unterlegen, als deklassiert und als Befehlsempfänger wahrgenommen, während es hieß, seine Bürger seien nun selbst ihres Glückes Schmied. „Das wurden sie aber nicht, weil die einen nicht konnten, die anderen nicht durften und die nächsten nicht wollten.“
Das Ergebnis ist eben keine Einheit, sondern eine Übernahme, bei der der eine sich übernommen hat, was der andere höhnisch beklatscht. Doch noch sei es möglich, Ostdeutschland zu retten, glaubt Ilko-Sascha Kowalczuk. Dazu müssten die Wunden von vor 1989 und die von danach allerdings nicht gegen einander aufgerechnet werden - sondern zusammen geheilt.
››Ilko-Sascha Kowalczuk: Die Übernahme. C. H. Beck, 318 Seiten, 16,95 Euro (mz)