Auf Defoes Spuren: "Der Schweizerische Robinson"
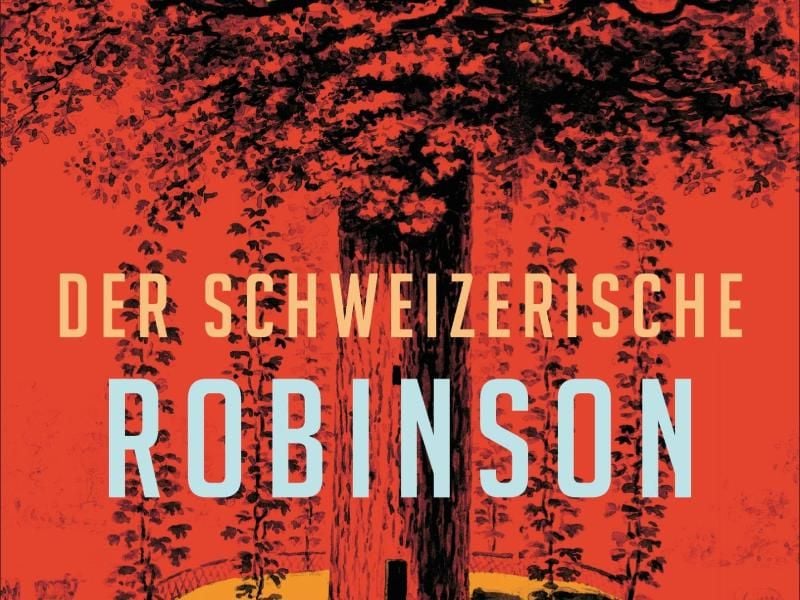
Hamburg - In der Berner Burgerbibliothek hat bis vor kurzem die Originalhandschrift eines der wirkmächtigsten Abenteuerbücher aus der Aufklärung geschlummert.
Es war ein ungerechter Schlaf: Denn „Der Schweizerische Robinson oder der schiffbrüchige Schweizer-Prediger und seine Familie” von Johann David Wyss ist schon weit vor Johanna Spyris „Heidi” einer der bedeutendsten eidgenössischen Romane. Jetzt liegt er nach langer Zeit wieder in ungekürzter Fassung vor.
Es geht auf eine einsame Insel. Im Nachklang zu Defoes genrebildendem „Robinson Crusoe” und den Abenteuern „Insel Felsenburg” (Schnabel) und „Robinson der Jüngere” (Campe) schreibt Wyss ein pietistisches Erziehungsbuch - ganz im Sinne des Humanismus, dessen Kind er ist.
Darin wird Ende des 18. Jahrhunderts eine Berner Pfarrerfamilie nach einem Schiffbruch in der Südsee an Land gespült. Über zehn Jahre berichtet der Erzähler vom Leben auf der Insel - in der für Robinsonaden nicht ungewöhnlichen Ich-Perspektive, damit die Geschehnisse autobiografisch erscheinen. Dieses utopische „Neu-Schweizerland” wird für die Familie bald zu einem besseren Ort als die europäische Heimat unter napoleonischem Joch.
Das Leben auf dem Eiland wird in realistischer Folge erzählt: der Tagesablauf vom Morgen- bis zum Abendgebet. Tiere werden gewaltsam untertan gemacht und domestiziert, allerlei Sträucher entbeert und Kokosschalen als Becher genutzt. Es ist die Herrschaft über die Natur. Rund 150 Tiere und 100 Pflanzen beschreibt dieser „große Herr Doctor Allesweiß”. Der Literaturkritiker Stefan Zweifel nennt das Buch in seinem lesenswerten Nachwort ein „Kompendium der Aufklärung”, das den Leser mit seinem „Mut zur Wunderlichkeit” anstecke.
Im Juni 1793 beginnt der 50-jährige Wyss mit der Niederschrift. Rund zehn Jahre arbeitet er am Roman, der ursprünglich der Unterhaltung und Belehrung seiner vier Söhne dienen soll - ohne dass der verwitwete Pfarrer je die Veröffentlichung im Kopf hat. Nach rund zehn Jahren liegen 841 eng beschriebene Seiten in Kurrentschrift vor. Die jetzige Ausgabe geht auf dieses Manuskript zurück. Mit dem Text erscheinen erstmals auch alle 60 meisterhaften Illustrationen exotischer Tiere und erzählter Szenen, die größtenteils Wyss' zweitjüngster Sohn Johann Emanuel zeichnete.
Im Bild festgehalten ist auch das Baumhaus namens „Falkenhorst”, einer der beiden Hauptwohnsitze der Roman-Familie. Es wird bald das Aushängeschild des Weltbestsellers. Gerade die Wohnung in den Ästen hat großen Einfluss auf den Erfolg des „Schweizerischen Robinson” besonders im angelsächsischen Raum - der soweit geht, dass Walt Disney die Geschichte 1960 verfilmt. In 20 Sprachen ist das Buch übersetzt. Schon Jules Verne fragt, welches fantasievolle Kind nicht bereits von den Abenteuern Defoes oder Wyss' geträumt habe.
Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt erkannte zwar einmal im „Schweizerischen Robinson” ein einfaches Strickmuster. „Aber es packt. Heute würden wir es vielleicht eine Familien-Soap nennen.” Er las neue Formen der Erziehung heraus - weg vom Befehlen und Einprügeln. „Eine ganze Familie lernt gemeinsam durch gemeinsame Praxis”, so von Matt. „Aber um das zu begreifen, muss man historisch lesen und das historische Lesen auf seine Art spannend finden.”
Und tatsächlich: Für heutige Leser sind nicht nur die altertümliche Sprache und die wundersamen Bilder fremd, auch das dargestellte Szenario ist teilweise erschreckend. Die patriarchale Moral bleibt stets unangefochten. Die Ideen der Aufklärung werden allein an den Vater als weißen, männlichen Kolonialisten gebunden. Alles, was von außen kommt, stellt eine Gefahr dar. Die gestrandete Familie ängstigt sich vor Fremden, obwohl es auf der Insel gar keine Ureinwohner gibt.
Hinzu kommt die ständige Brutalität bei der Unterwerfung der Natur: „Doch zappelte das zähe Thier noch so gewaltig mit in den Füßen, dass ich auch von diesen ein Paar ihm vom Leibe trennte, worauf es denn allmählig sich ergab, und endlich verblutete.” Im menschlichen Urtrieb verstümmeln die Söhne unter „lautem Triumphgeschrey” eine Schildkröte. Gerade solche Episoden wurden immer wieder zensiert, und so das Original bisweilen bis zur Unkenntlichkeit eingekürzt.
Reißende Abenteuerepisoden waren lange Zeit interessanter als die wuchtige Urbarmachung oder das pietistische Einsiedlerleben der Protestantenfamilie. Mit der jetzigen „Robinson”-Ausgabe ist die Utopie endlich wieder in all ihren sonderbaren Facetten zu genießen.
- Johann David Wyss: Der Schweizerische Robinson. Die Andere Bibliothek, 1176 S., 68,00 Euro, ISBN 9783847703839. (dpa)




