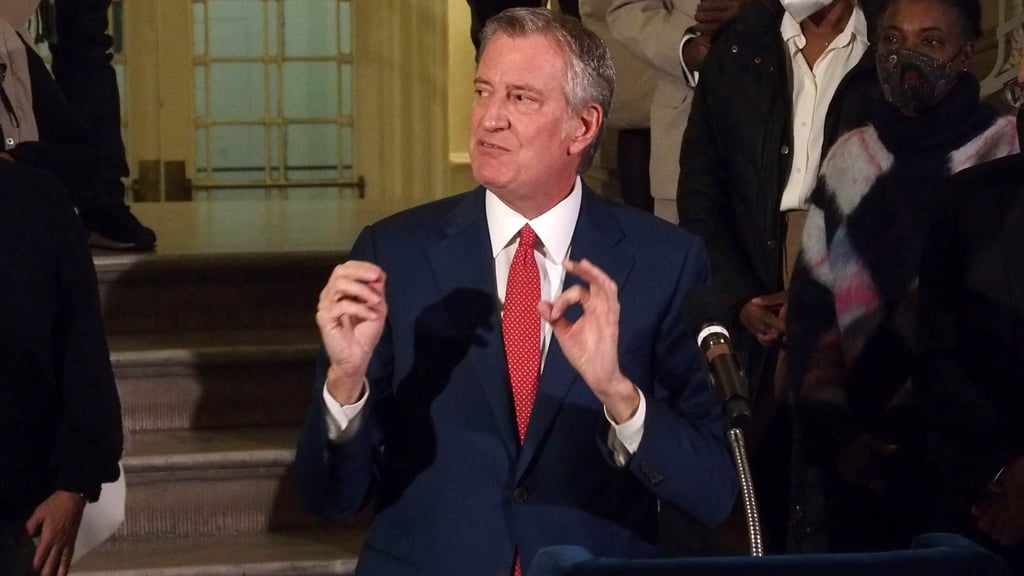Anhalt 800 Anhalt 800: Ein Grabmal aus dunkler Zeit
Ballenstedt/MZ. - Hoch auf Schloss Ballenstedt liegt Albrecht der Bär begraben, Stammherr des Hauses Anhalt. Der Weg zu seiner Grabesstätte führt durch ein rasselndes Drehkreuz aus Edelstahl, wie man es unter anderem von Bahnhofstoiletten kennt. Gänzlich unbeabsichtigt kratzt diese Art des Eintretens doch ein wenig an der Aura des Ortes. Zum Glück vielleicht, denn das Grab des Fürsten verdankt seine Inszenierung den Nazis.
"Entwertet, verfälscht, zerstört" nennt der Anhalt-Bauforscher Winfried Korf das, was nach 1938 von der Nikolaikapelle übrig blieb, einem Raum unter dem nördlichen der beiden Türme des trutzigen Westwerks der einstigen Klosterkirche, die 1525 größtenteils dem Schlossbau weichen musste. Doch das eigentlich Erstaunliche ist, dass Albrechts Grablege von 1170, zur Weihestätte umgedeutet, zwar nur noch von Touristen scheu beäugt statt von stramm stehenden Fahnenträgern salutiert wird, jedoch seine Aura bis heute unverändert und unkommentiert bewahrt.
Den Leiter des Ballenstedter Stadtmuseums, Eberhard Nier, scheint diese Beobachtung zu überraschen. Er kennt die Geschicke des Schlosses wie kaum ein anderer, und hat viel getan, um Besuchern auf Tafeln Albrechts Lebensdaten und die verzweigte Ahnenreihe des Hauses Anhalt näher zu bringen. "Die Gruft ist ein unverfälschtes Zeugnis vom Geist der damaligen Zeit", sagt er. Nur welcher Geist, steht nirgends vermerkt.
Es ist auch gar nicht so leicht, dazu Dokumente aufzutreiben. Das städtische Archiv meldet Fehlanzeige. Ein Hinweis aus dem Stadtplanungsamt, in den Schubläden lägen noch Zeichnungen vom Heimatstil-Baumeister und Rassetheoretiker Paul Schulze-Naumburg, der die Weihestätte entwarf, erweist sich als nur halb wahr - es finden sich mit "Schulze" signierte Blätter, aber die zeigen eine Bestandsaufnahme des ursprünglichen Zustands.
Man blickt also in Ballenstedt auf einen Albrecht, der für das NS-Weltbild passend gemacht wurde. So wie König Heinrich I. und Heinrich der Löwe in den Stiftskirchen von Quedlinburg und Braunschweig, doch wurden diese "Weihestätten" nach dem Krieg rasch neutralisiert. In Ballenstedt dagegen inszeniert die Grabkammer immer noch ein dräuend-heroisches Mittelalter. In die Wände aus wuchtigen Quadern sind zwei kleine Blendbögen eingelassen, originale Bruchstücke von der Burgruine Anhalt. Mittig davor ist ein Säulenkapitell wohl aus der alten Klosterkirche aufgestellt und flankiert von schmiedeisernen Kerzenständern. Pflichtschuldigst hat die Stadt sie mit Kerzen bestückt.
In der Nische über dem Kapitell lehnt die Bronzetafel mit der damals ausgedachten Grabinschrift, durchsetzt mit codierten Vokabeln: "Markgraf Albrecht der Bär - Der Wegbereiter ins deutsche Ostland". Polen ist zu dieser Zeit schon besetzt, aus dem Geschichtsbild der Gruft heraus sozusagen in später Erfüllung eines Auftrags. Ein Historienbild des Leipziger NS-Malers Karl Bloßfeld im Bernburger Ratssaal (heute im Museumsdepot), zeigt Albrecht hoch zu Ross, der mit den Sachsen gegen die plündernden Slawen zu Felde zieht.
Heutzutage begegnet der bekannte Potsdamer Albrecht-Biograf Lutz Partenheimer dieser gefärbten Sichtweise mit einiger Ironie. Denn für ihn offenbart sich in Albrecht ein Fürst, der zwar wie damals üblich seine Interessen mit Kriegsführung verfolgte - so 1147 im sogenannten Wendenkreuzzug gegen die Ost-Slawen -, aber für seine Ziele auch Diplomatie einsetzte. Seinen Anspruch auf die Brandenburg handelte er um 1125, sagt Partenheimer, mit Pribislaw-Heinrich aus. Dieser Angehörige einer slawischen Herrscherfamilie wollte auf der Burg König des slawischen Heveller-Volksstamms werden und gab Albrecht für seine Unterstützung die Zusicherung, dass die Burg nach seinem Tod an ihn fallen würde. Erobert hat Albrecht sie erst 1157 aus der Hand eines Usurpators.
Für derlei Feinheiten hatten die Nazis keinen Blick. Das inszenierte Albrecht-Grab sollte dazu dienen, den Kampfeswillen der Hitlerjugend zu stählen. Die wurde in der "Napobi" herangezogen, der "Nationalpolitischen Bildungsanstalt". Die Kasernen stehen in ihrer martialischen Symmetrie heute noch auf dem nahen Ziegenberg in Ballenstedt - verlassen und leer, nachdem auch ihre spätere Karriere als SED-Parteischule Geschichte ist.
Museumsleiter Nier hat Fotokopien vom "Ballenstedter Kreisblatt" zur Hand, das am 9. / 10. Juli 1938 von der bevorstehenden Einweihung der Weihestätte berichtet: im Zeichen eines Albrecht, der "das zurück gewonnene Neuland mit deutschen Menschen besiedelte." Mit Fahnen und Spielmannsklang, jubelt der Reporter, werden in der kommenden Julinacht die HJ-Einheiten einmarschieren und am Grab "Ehrenwache" halten.
Der Gauleiter ruft ihnen zu, sie würden den "Ostkolonisationsgedanken" bald bei den "Fahrtentagen" in den "deutschen Osten" tragen. Das, was die Grabstätte aus der Sicht des Bauhistorikers Korf einmal war, ist sie nicht mehr - der Ort, an dem die toten Askanier "ewig präsent" waren wie die lebenden auf der Fürstenempore der Stiftskirche. Es kam anders, in letzter Konsequenz der Nazi-Umdeutung des Albrechtschen Erbes: die Sowjets enteigneten die Familie und verschleppten den letzten Schlossherrn Joachim Ernst ins "Speziallager" Buchenwald, wo er 1947 starb. An all diese Zusammenhänge zu erinnern, würde endlich Licht in die Düsternis der "Weihestätte" werfen.
November-April, Di-So 10-16, Mai-Oktober 10-17 Uhr.