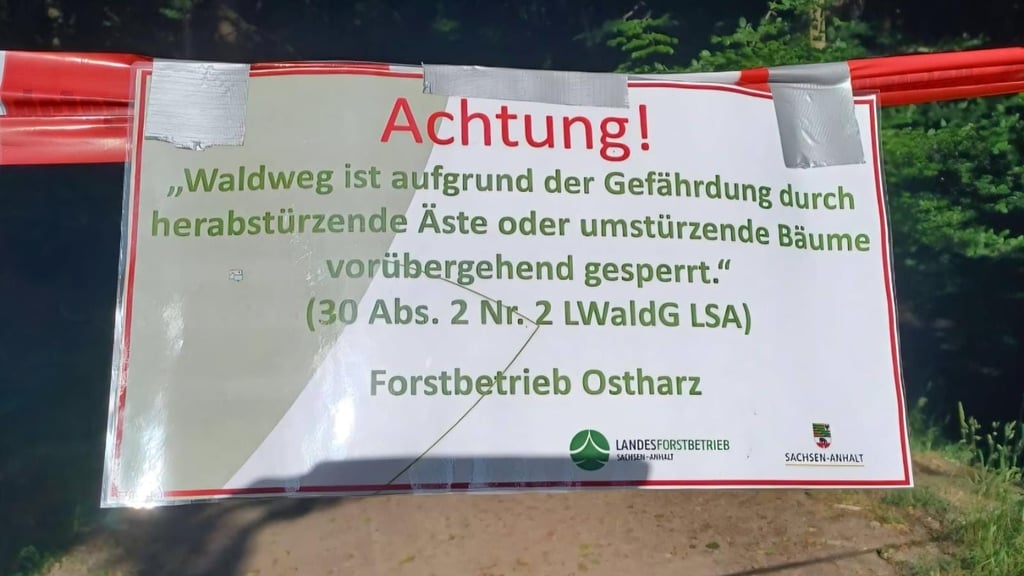Porträt über Margarethe von Eckenbrecher Porträt über Margarethe von Eckenbrecher: Was Afrika ihr gab und nahm

Bernburg - Als ihre Biografie „Was Afrika mir gab und nahm“ im Jahr 1907 erschien, war die Bernburgerin Margarethe von Eckenbrecher gerade einmal 31 Jahre alt. Und doch hatte sie in den fünf Jahren zuvor schon so einige Schicksalsschläge erfahren: So hatte sich die Lehrerin zunächst als Farmerin recht erfolgreich in Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia) behauptet, bis sie 1904 während des blutigen Herero-Aufstands ihre Existenzgrundlage verlor und nach Deutschland fliehen musste. Im Jahr darauf war ihr Bruder Hans Hopfer, der ebenfalls als Pflanzer ausgewandert war, in Deutsch-Ostafrika (dem heutigen Tansania) während des dortigen Maji-Maji-Aufstandes von Eingeborenen ermordet worden.
Ehemann verdient nichts
Neben den wechselvollen Jahren in Afrika durchlebte Margarethe von Eckenbrecher nach ihrer Rückkehr in die deutsche Heimat eine wirtschaftlich schwierige Situation: Ihr Gatte fand als ehemaliger Reserveoffizier der kaiserlichen Schutztruppen keine Anstellung im Zivilleben, so dass sie allein die Familie, zu der zwei Söhne gehörten, ernähren musste.
In ihrer Biografie machte sich die viel geforderte Frau Luft, aber nicht anklagend oder verbittert. Auch nicht – wie so oft in der damaligen Afrika-Literatur – mit rassistischen Auslassungen. Eckenbrecher beschrieb völlig ungeschönt und vorurteilsfrei die „Erlebnisse einer deutschen Frau in Südwestafrika“ – so der Untertitel – und erreichte damit eine überraschend große Leserschaft, die von der Exotik Afrikas fasziniert und von dem Frauenschicksal berührt war.
Schon 1909 erschien ihre Biografie in der fünften Auflage, bis 1913 hatten sich 14 000 Exemplare verkauft. Eine neue, um ihre Erlebnisse bis 1936 ergänzte Ausgabe erlebte bis 1940 weitere acht Auflagen. Noch heute wird diese Biografie in deutschen und namibischen Verlagen gedruckt – als bedeutendes Zeitdokument und einer der wenigen Lebensberichte seiner Zeit, der sich in Deutschland wie in Namibia immer noch ungebrochener Beliebtheit erfreut.
Geboren wurde Margarethe Hopfer am 30. September 1875 in Bernburg, wo sie eine Ausbildung zur Lehrerin absolvierte, bevor sie für einige Jahre in Deutschland und England den Schuldienst versah. Im April 1902 heiratete sie in Berlin den mecklenburgischen Landschaftsmaler Themistokles von Eckenbrecher (1876–1935), der zwischen 1895 und 1900 in der Schutztruppe gedient hatte und dem sie nach Deutsch-Südwestafrika folgte. Dort wurde im Folgejahr Sohn Themistokles, genannt Bitz, geboren.
Nach zwei glücklichen Jahren in Afrika und der überstürzten Flucht nach Deutschland, über die Eckenbrecher eine Fehlgeburt erlitt, lebte die Bernburgerin mit ihrer Familie in Braunschweig und Weimar, wo sie als Lehrerin arbeitete. Nachdem 1905 mit Hans-Henning, genannt Büdi, ein zweiter Sohn geboren war, verfasste Eckenbrecher ihren Lebensbericht. Dessen unerwarteter Erfolg ermutigte die selbstbewusste Frau, sich 1913 von ihrem notorisch faulen Gatten scheiden zu lassen. Im selben Jahr siedelte sie mit ihren Söhnen zurück nach Afrika.
Großes Ansehen in Namibia
Dort arbeitete sie weiterhin als Lehrerin und erwarb sich großes Ansehen bei der weißen wie schwarzen Bevölkerung. Ihre Söhne aber konnten in diesem Leben zwischen den Welten kaum Fuß fassen: Bitz trat 1919 eine Ausbildung in Hamburg an, scheiterte aber in dem Wunsch, Rechtsanwalt zu werden, da er in Namibia aus formalen Gründen nicht zum Studium zugelassen wurde. Bis zu seinem Lebensende im Jahr 1976 schlug er sich mit Gelegenheitsarbeiten, zum Teil in der Illegalität, durch. Büdi hatte 1923 in Hamburg eine Ausbildung zum Kaufmann begonnen, sie allerdings aufgrund von Heimweh bereits nach einem Jahr wieder abgebrochen. In Namibia ließ er sich zum Buchhändler ausbilden, verstarb allerdings bereits 1927 im Alter von nur 22 Jahren an Typhus.
Margarethe von Eckenbrecher arbeitete bis zu ihrer Pensionierung 1935 als Lehrerin in Namibia. Im Ruhestand überarbeitete sie ihre Biografie, die in Deutschland erneut auf große Resonanz stieß. Die Autorin verstarb 1955 in Windhoek, wo sie an der Seite ihres Sohnes Büdi auf dem Neuen Friedhof beigesetzt wurde. (mz)